
 |
... Vorige Seite
Freitag, 28. Februar 2003
Kitsch (Forts.)
knoerer
09:15h
Wo wir schon von Kitsch reden: schlimmer als Libeskind, nun auch in New York, geht's nimmer. Dekonstruktives Bauen für Klippschüler. Der moralische Zeigefinger diesmal 514 Meter hoch. Add.: Und in der FAZ liest sich das ganz passend so: "Die Art.., in der Libeskind den schartigen Krater, der einmal das Fundament des World Trade Centers gewesen ist, für aller Augen sichtbar lässt und einige seiner schrundigen Betonränder mittels gläserner facettierter Bauten wie in Edelstein fasst, die ihrerseits in der kristallinen Riesenschatulle einer Gedenkhalle gebündelt werden - das alles ist vom gleichen tragischen Ernst, den der Architekt beim Bau des Berliner Jüdischen Museums Gestalt werden ließ." Ich sollte hinzufügen: vielleicht sind es nicht 514, sondern 541 Meter oder, andernorts zu lesen, 530. Der Punkt ist: umgerechnet ergibt das 1776 Fuß. Und 1776, werte Kenner der amerikanischen Geschichte... Es ist diese ungeheure Plumpheit der Symbolik, bei der ich Gänsehaut bekomme. Nicht anders ist's bei den mit viel Pathos beschworenen "Voids" des Jüdischen Museums. Es steckt jeweils ein halber Gedanke in dieser Art symbolischen Bedeutens: aber welch eine Welt der Dummheit eröffnet sich dahinter im Glauben, der Erinnerung an den Holocaust oder den Terror sei so simpel memorial-ästhetische Form zu geben. ... Link Donnerstag, 27. Februar 2003
Jackass
knoerer
09:22h
Es handelt sich hierbei offenkundig um einen Film als Phänomen, das als solches, nicht als Werk von Interesse ist. Das heißt immer auch, dass die erläuternden Diskurse sehr viel interessanter sind als das, was zu sehen sein dürfte. Kluge Kritiken ersparen einem also die Qual des rezeptiven Selbstversuchs. Ein Glück, dass Andreas Busche eine solche in der taz geschrieben hat. ... Link Dienstag, 25. Februar 2003
Blanchot-Kitsch
knoerer
09:56h
"Die Literatur ist die Selbstinfragestellung der Literatur. Sie ist, wie Blanchot über Proust bemerkt, zitternde Hand, die schreibt. In ihrem Horizont steht kein Autor-Ich, kein Leser, keine Historie, keine Welt, sondern ein monomanes, oszillierendes Verströmen von Energien, die die Literatur erschaffen wollen. Blanchots Essaysammlungen La part du feu (1947), L'espace littéraire (1955), Le livre à venir (1959), L'entretien infini (1969), De Kafka à Kafka (1981) umkreisen diese Thematik der Literatur als Literatur immer neu: die Literatur als das einzige, einzigartige Sprechen, das sich um seiner Möglichkeit willen, seines Ergehens wegen auslöscht." Wie einer - Manfred Schneider tut es - dies als emphatisches Lob meinen kann, als Beschreibung des letzten Endes der Literatur: das will mir nicht in den Kopf. Es steckt - und so offenkundig - eine solch kompakte Ladung Metaphysik in diesem Anspruch an die Literatur, ein Glaube daran, dass es um die WAHRHEIT im engsten Verstande geht, um ein Höchstes, das doch ganz offensichtlich der nächste Schwippschwager Gottes ist. Ersichtlich schon daran, dass dieses Verständnis der Literatur als philosophisches seinen Gipfel in raffinierten Formen negativer Theologie findet: im Scheitern, im Abbruch, der die Anstrengung erst beglaubigt und in der Notwendigkeit der Darstellung, auf dieses Scheitern aufzulaufen. Dies noch, über Blanchots Werk "L'écriture du désastre": "Es ist der Versuch, in einer langen Reihe von Meditationen und Zitaten die Desaster des 20. Jahrhunderts in einer Schrift zu umkreisen, die selbst das Desaster dieser Unmöglichkeit schreibt." Es ist das der reine poststrukturalistische Kitsch. Das Schreiben der Desaster der Unmöglichkeit. Der Heidegger-Kern, der in De Man und Derrida tief drin steckt und ausgerechnet in der philosophisch vereinnahmenden Beschäftigung mit der Literatur immer wieder herauskommt. Blanchot ist, versteht sich, einer der liebsten Zeugen. Kafka, Beckett, Celan. Ich mag's lieber die eine oder andere Nummer kleiner. ... Link Montag, 17. Februar 2003
Kaum zu glauben
knoerer
15:58h
Ich wähnte mich ja eigentlich ganz und gar out of tune mit dem aktuellen Musikgeschehen - und dann fällt mein Blick auf den Plattenspiegel im tip. Sind doch auf Platz 1 bis 4 nicht nur Musiker & Bands, die ich kenne, sondern sogar solche, die ich liebe, mehr oder weniger. Bonnie "Prince" Billy alias Will Oldham habe ich schon in seinen früheren Inkarnationen als "Palace" oder "Palace Brothers" sehr verehrt - und die ganz große Vorgängerplatte hat mir jemand, nun, zu meinen Zeiten sagte man "überspielt". Kutter schrieb was von Nick-Drake-Nachfolge, das ist korrekt - und inzwischen ist Oldham vielleicht sogar genauso gut. Auf Platz zwei Richard Thompson, dessen Mirror Blue ich Mitte der neunziger Jahre, als ich in dem Kaff, in dem ich aufgewachsen bin, Taxi fuhr, wartend und Gäste durch die Gegend kutschierend bestimmt hundertmal gehört habe (auf der Rückseite war, auch wenn das nichts zur Sache tut, die eine geniale Platte, die Maria McKee gemacht hat - You Gotta Sin to Get Saved). Seltsame Prägungen sind das... Auf Platz drei Calexico, die, naja, nicht so ganz genial sind und gelegentlich mit allzu viel Folklore nerven, aber denen wg. Verbindung zu Giant Sand alles zu verzeihen ist. Dann die Go-Betweens. Gibt's wieder (zweite neue CD), scheinen sich alle drüber zu freuen, ich tu's natürlich auch. Wobei mir Grant McLennans Solo "Horsebreaker Star" - ich weiß, das ist eine problematische Ansicht - vielleicht sogar lieber ist als die ganzen Go-Betweens-Alben before and after. Letzten Mittwoch spielte übrigens meine einstige Lieblingsband Camper Van Beethoven, auch erst sehr unlängst von den Toten auferstanden, in Berlin und ich war, berlinalebedingt, einfach nicht in der Lage, da hinzugehen. Aber wer weiß, ist mir ja vielleicht eine Enttäuschung erspart geblieben. ... Link Samstag, 15. Februar 2003
Berlinale Abschluss-Kommentar
knoerer
16:36h
Drei Filme habe ich gesehen auf der diesjährigen Berlinale, deren Bilder ich so schnell nicht vergessen werde - Murnau, Ozu und die Shaw-Brothers mit ihren jeweiligen Retrospektiven natürlich nicht gezählt. Es waren das Patrice Chereaus "Son Frere", Johnnie Tos "PTU" und Christian Petzolds "Wolfsburg". Nur einer davon, "Son Frere", lief im Wettbewerb, die anderen beiden hatte man im Forum und im Panorama versteckt. Natürlich weiß jeder, dass die vermeintlichen Nebenreihen oft genug - neben manch Obskurem - die aufregenderen, die kühneren und intelligenteren Filme zeigen; für den Verzicht auf die konzentrierte Aufmerksamkeit der filminteressierten Weltöffentlichkeit ist dieses Wissen aber kein Ersatz. Zu unüberschaubar sind die Programme von Panorama und Forum, zu diffus bleiben die Reaktionen, um über die Wirkung auf einzelne hinaus genug Licht auf die herausragenden Filme zu werfen. So wurde etwa "PTU" (als Weltpremiere im Forum zu sehen) kaum besprochen, Johnnie Tos bisher gewagtester Film (unsere Reaktion hier). Mit dieser Polizei-Ballade entfernt er sich mutig vom Hongkong-Action-Kino, dessen derzeit größter Meister er ist. Größere formale Eleganz war nirgends zu bewundern, To besitzt ein Rhythmusgefühl, das mehr mit Kino zu tun hat als begrüßenswerte Polit-Botschaften oder gar die mehr oder weniger manipulativen Emotionsmaschinchen, die Hollywood mit "The Hours" oder "Das Leben des David Gale" ins Rennen geschickt hatte. Dabei wurde "The Hours", der nicht mehr als Kunstgewerbe auf höchstem Niveau zeigte, sogar als Favorit gehandelt. Die Jury traf jedoch die richtige Entscheidung und zeichnete allein die drei Hauptdarstellerinnen mit dem Silbernen Bären aus: Meryl Streep, Nicole Kidman und Julianne Moore teilen sich den Preis. Von den Wettbewerbsfilmen kam Steven Soderberghs "Solaris" der formalen Intelligenz Tos noch am nächsten. Nach seinen eher enttäuschenden letzten Filmen "Ocean's Eleven" und "Full Frontal" beweist Soderbergh mit seinem neuen Werk, dass er in Bildern und mit der Montage zu denken versteht wie kaum ein anderer in Hollywood. Allerdings wird die Wirkung des Films nicht zuletzt durch die - neben Ed Harris' Geschauspielere in "The Hours" - manierierteste Darstellerleistung des Wettbewerbs beeinträchtigt (über "Ja Zuster, Nee Zuster" decken wir lieber gnädig den Mantel des Schweigens): der Goldene Gummibär für Grimassieren und Gefuchtel geht an Jeremy Davies. Das - unter Inkaufnahme teils beträchtlicher Nähe zum Kitsch - bildmächtigste Werk des Wettbewerbs war Zhang Yimous politisch freilich höchst fragwürdiges Martial-Arts-Epos "Hero", das immerhin den nach dem Berlinale-Gründer benannten Alfred-Bauer-Preis erhielt. Gleich zweimal vertreten war der Drehbuchautor Charlie Kaufman im Wettbewerb. In "Adaptation" hat er sich gleich selbst in den Film geschrieben und in einem Akt der Schizophrenie einen Zwillingsbruder gleich dazu. Beide differieren beträchtlich in ihrem Schreibansatz, Action will der eine, der andere liefert eher eine Art postmodernen Existenzialismus. Das Ergebnis ist eine höchst selbstreflexive Mischung aus beidem - die Pointen jedoch sind vorhersehbar und Spike Jonzes Regie bleibt (wie schon in "Being John Malkovich") einfallslos. "Adaptation" erhielt den Großen Preis der Jury. Über George Clooneys Debüt "Confessions of a Dangerous Mind" wird man dasselbe nicht sagen können. Die Undiszipliniertheit von Kaufmans Skript wird hier durch die Regie, die jedem passenden und leider auch jedem unpassenden Einfall nachgibt, noch verdoppelt. Der Silberne Bär für den Hauptdarsteller Sam Rockwell und seine Tour-de-Force-Leistung als Fernsehproduzent und CIA-Killer Chuck Barris jedoch ist durchaus gerechtfertigt. Ähnlich unkonzentriert wie Clooney ging nur Spike Lee zu Werke, dessen Moritat vom verantwortungslosen Drogendealer, "The 25th Hour", den 11. September, sämtliche in Manhattan aufzutreibenden Ethnien und mehr als eine überflüssige Nebengeschichte unter einen Hut bekommen wollte. Das Ergebnis fiel erwartungsgemäß viel zu lang, viel zu redselig und auf die Dauer ungeheuer ermüdend aus. Eher finster ging es zu im Wettbewerb, die Presse gewöhnte sich nur mühsam an die regelmäßig zur frühen Morgenstunde ausgeteilten weltpolitischen Tiefschläge . Der beste unter den politischen Filmen blieb der erste, Michael Winterbottoms "In This World", das halbdokumentarische Road-Movie einer Flucht von Pakistan nach London. Beherzt folgt die digitale Kamera ihren Hauptfiguren und die heikle Gratwanderung zwischen Realität und Fiktion, die der Film unternimmt, glückt durchweg. Der Goldene Bär für "In This World" geht deshalb völlig in Ordnung. Zwei Filme postierten sich und ihre Geschichten ausdrücklich an der EU-Außengrenze, Damjan Kozoles Schleuser-Porträt "Ersatzteile" an der italienisch-slowenischen, Hans-Christian Schmids Episodenfilm "Lichter" an der deutsch-polnischen. Womit wir bei den deutschen Filmen wären. Schmid, ohne Frage einer der vielversprechendsten unter den jüngeren deutschen Regisseuren, enttäuschte mit seinem Ensemblestück. Zu plakativ fielen die einzelnen Geschichten aus, zu wenig Raum blieb angesichts des abzuarbeitenden Erzählpensums für die Details, fürs Nebenbei, als dessen Meister sich der Regisseur in seinen bisherigen Filmen erwiesen hatte. Dem freundlichen Echo bei Presse und Publikum zum Trotz: Wolfgang Beckers mit Spannung erwartete DDR-Tragikomödie "Good Bye, Lenin!" scheitert auf der ganzen Linie, und zwar am Unvermögen des Drehbuchs, aus der hübschen Grundidee - ein Sohn gaukelt seiner Mutter die Weiterexistenz der DDR nach der Wiedervereinigung vor - mehr als die absehbaren Pointen zu entwickeln. Ein bisschen mehr als ein Trostpreis ist der von der Jury an den Film vergebene "Blaue Engel". Der mit Abstand beste deutsche Film freilich lief nicht im Wettbewerb, sondern im Panorama, Christian Petzolds fürs Fernsehen entstandenes Auto-Schuld-und-Sühne-Drama mit dem sehr treffenden Titel "Wolfsburg", das aus der Strenge seiner Form eine bewegende Geschichte entwickelt, deren Präzision keiner der anderen deutschen Filme nahe kam. Der beste, der einzige wirklich große Film des Wettbewerbs war jedoch Patrice Chereaus Brüderdrama "Son Frere", das den mit "Intimacy" eingeschlagenen Weg der Erkundung des menschlichen Intimbereichs radikalisierend fortsetzte. Spektakuläre Bilder hat Chereau dabei nicht nötig - das Wunder seines Films ist eine Eindringlichkeit, die sich aus dem Verzicht auf psychologische Erklärungen, aus dem beharrlichen Blick auf sich auflösende Grenzen des Zwischenmenschlichen ergibt. Atemberaubend der Musikeinsatz, unendlich weit entfernt vom gefühlserpresserischen Philip-Glass-Gedudel von "The Hours"; erst kurz vor Schluss durchbricht Chereau die bis dahin ganz auf Geräusche und Dialoge konzentrierte Musiklosigkeit. Die Wirkung des bewusst gesetzten Pathos ist ungeheuer: einen größeren Moment als die ersten Klänge von Marianne Faithfulls Song hatte das Festival nicht zu bieten. Nach dem Goldenen Bären für "Intimacy" vor zwei Jahren wollte die Jury wohl nicht erneut den Hauptpreis an Chereau vergeben. Zur Entscheidung, ihm den Silbernen Bären für die Beste Regie zu verleihen, kann man ihr daher nur gratulieren. ... Link
Comandante (Oliver Stone, USA 2003)
knoerer
16:34h
Keine Frage: Oliver Stone hat sich verliebt. In Kuba, zum einen, dann aber auch, Hals über Kopf, in Fidel Castro, den "Comandante", den er in seinem Interview-Dokumentarfilm gleichen Titels porträtiert. Dreißig Stunden Material hat er auf neunzig Minuten gekürzt und ist dann doch selbst öfter, als es einem bescheidenen Mann geziemt, im Bild. Stone stellt Fragen, philosophische, politische, private - und er bekommt oft genug Antworten. Sensationelles erfährt man nicht. Nein, Folter, hat es in Kuba nie gegeben, und Che Guevara war ein wenig ungeduldig. Castro legt den Arm um Stones Schulter, krault sich im Bart und versichert, dass er durch den Verzicht auf die morgendliche Rasur Monate seiner Lebenszeit gespart habe. Die Chemie stimmt zwischen den beiden, keine Frage, irgendwann landen sie sogar bei Viagra-Scherzen. Fidel Castro ist ein gewinnender Mensch, das bestätigt der Film, der, wie Stone in der Pressekonferenz (zu der Castro sogar beinahe gekommen wäre) mehrmals versichert, nicht mehr als ein persönliches Porträt einer historischen Legende sein soll. Auf alle kritischen Nachfragen zur vielleicht etwas zu affirmativen politischen Haltung von "Comandante" reagiert Stone gereizt. Was, meint er etwa, sei die Demokratie wert, wenn sie doch nur eine Frage des Geldes ist. Kuba sei das Paradies, wenigstens im Vergleich zu Staaten wie Brasilien oder Honduras. Worum auch immer es geht, Stone kann nicht anders, als das Kind mit dem Bad auszuschütten - und wenn er sich Fidel Castro dabei an die Brust wirft. Immerhin hat der die Stone-Filme "Platoon" gesehen, und auch "JFK". Im Gespräch versichert Castro dem strahlenden Regisseur, dass er sehr skeptisch sei, was die Alleintäterschaft Lee Harvey Oswalds angeht. Stilistisch ist "Comandante" reiner Oliver Stone, also ein wilder Ansturm der Bilder, eine Reihung von Pawlowschen Reflexen, auf die bei ihm Verlass ist. Spricht Castro von der Atombombe, ist im nächsten Bild ein Atompilz zu sehen. Die digitalen Bilder zucken um Castro herum, ohne Sinn und Verstand schneidet Stone von einer Nahaufnahme des Gesichts zur nächsten, Hauptsache, es bewegt sich was. Historisches Material dazwischen, eine Handvoll kubanische Musik darunter, kein Klischee ist zu dumm, keine Assoziation zu hanebüchen. Wie stets geht es ihm bei seinen Zerlegungen der Bilder nicht um Analyse, schon gar nicht um Reflexion. Dinge, die man besser getrennt hielte, werden zusammengerührt, dass einem Hören und Sehen vergeht. Andererseits: das war alles klar. Oliver Stone ist nicht Günter Gaus. Und ein trotz aller Einwände interessanter Blick auf einen faszinierenden Menschen ist "Comandante" allemal. ... Link Freitag, 14. Februar 2003
Der alte Affe Angst (Oskar Roehler, D 2003)
knoerer
11:40h
In letzter Minute ist Daniel Auteuils Bruno in Pascal Bonitzers „Petites Coupures“ im Wettbewerb um die unsympathischste Hauptfigur geschlagen worden, und zwar um Längen. Die Zumutung nämlich, die der Regisseur Robert (trotzdem brillant: André Hennicke) in Oskar Roehlers „Der alte Affe Angst“ für den Zuschauer darstellt, ist beträchtlich. Das reine Klischee des leidenden Künstlers, egozentrisch, rücksichtslos und bis zum Kragen im Selbstmitleid schwimmend. Seine Freundin Marie (Marie Bäumer) begehrt er nicht mehr, betrügt sie deshalb mit Nutten, ein ums andere Mal, für die Frau seines Lebens hält er sie dennoch. Er macht eine Therapie, ihr zuliebe, wie er einmal sagt, der Therapeut bestätigt ihn zu allem Überfluss in seinem Selbstbild. Oskar Roehler ist entschlossen, sich ausgerechnet in eine solche Figur zu verbohren, sie auszuziehen bis auf die Haut, ihr Inneres zu entblößen vor versammeltem Publikum. Das muss man nicht mitmachen wollen – und die Buhs der Presse nach der Vorführung kann man verstehen. „Der alte Affe Angst“ ist ein Trip nicht so sehr durch die Abgründe als durch die Sümpfe einer Seele, hautnah dran bleibt er am hysterischen Hin und Her einer Beziehung zwischen kindischem Herumtollen und kreischenden Vorwürfen, hält drauf, wenn Marie in der Wanne liegt, mit aufgeschnittenen Pulsadern, und wenn Robert die Prostituierte Lisa vögelt. Damit lange nicht genug des Elends. Marie ist Ärztin in einer Kinderstation, ein Kind liegt im Sterben und auch die Mutter ist HIV-positiv. Außerdem ist sie die Prostituierte Lisa – und daran wird schon deutlich, dass Roehler kein Halten kennt, im guten wie im bösen, Angst auf Schrecken häuft, finstere Schicksale nimmt, woher er sie kriegen kann. Dann ist da noch Roberts Vater (Vadim Glowna), auch er, wundert keinen mehr, todkrank, im Sterben, seinen letzten Roman (komisch, dass der Plot, den er erzählt, so frappierend ausgerechnet an „Solaris“ erinnert) kann er nicht mehr fertig schreiben. Robert fühlt sich belästigt durchs Leid des Vaters und als er sich doch noch entschließt, ihn bei sich aufzunehmen, ist er tot. Was noch? Ein Theaterstück mit nackten Menschen, die im Chor brüllen wie in einem schlechten Schleef-Imitat, „Wir haben Angst“ rufen sie, der Autor des Stücks ist Robert, der Autor des Films ist Oskar Roehler und wir haben längst begriffen, was er uns zeigen will. Natürlich kennt er dennoch kein Pardon, es geht immer weiter so, das Geschrei und der Streit, bei Nacht und bei Tage. Alle Subtilitäten sind von der ersten Minute an über Bord geworfen, „Der alte Affe Angst“ will immer nur hinaus auf den Exzess – wenngleich er ihn ausspielt gegen Kontrastmomente der Ruhe, unterlegt mit klassischer Streichkonzertmusik. Was er Marie und Robert zuletzt gönnt, sieht auf den ersten Blick aus wie ein Happy End. Nach ihrem Selbstmordversuch bleibt sie unter Beobachtung, Robert kommt zu Besuch. Sie umarmen sich, die Kamera kreiselt um sie, sie tollen durchs Gras, sie flicht ihm Gänseblümchen ins Haar. Schwer zu sagen, wie ernst das gemeint ist, die Fortsetzung dieser Hölle ist nichts, das man irgendjemandem wünschen möchte. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8770 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

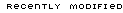
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||