
 |
... Vorige Seite
Freitag, 14. Februar 2003
Twilight Samurai (Yoji Yamada, Japan 2002)
knoerer
07:55h
Seibei ist ein Samurai, mit dem Herzen bei der Sache ist er jedoch nicht. Seit dem Tod seiner Frau versorgt er seine beiden Töchter als alleinerziehender Vater mit kümmerlichem Gehalt (und seine demente Mutter dazu). Da kann es schon mal passieren, dass er etwas strenger riechend zur Arbeit erscheint. Stolz ist dort keiner auf ihn, sein Onkel will eine hässliche Frau an ihn verschachern, mehr darf er nicht erwarten. Allerdings gibt es da noch Tomoe, die Kindheitsfreundin, die ein Auge auf ihn geworfen hat, er aber will ihr das Leben in Armut und Arbeit nicht zumuten. Kurz, Seibei ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein, ein Mensch ohne Ehrgeiz, der dennoch zuletzt einen bedeutenden Auftrag auszuführen hat, ob er will oder nicht. Ein realistischeres Bild der Samurais wollte er zeichnen, meint Regisseur Yoji Yamada. Kann sein, dass ihm das gelungen ist. Seibei ist ein gar nicht übler Schwertkämpfer und geht einem mit allzuviel Edelmut auf die Nerven. Ansonsten ist er einer wie du und ich. Ziemlich langweilig also, kein Held für einen Film, in dem weiter nichts geschieht. Ein bisschen Liebeswerben, kleine Scherze, eine schnurrige Geschichte. Die Kamera beobachtet meist aus der typisch japanischen Tiefebene, aber einfach so, ohne formalen Ehrgeiz. Die Bilder sind illustrativ und stets geschieht, was man lange schon erwartet hat. Je länger der Film dauert, desto stärker wird der Wunsch, dem Helden und dem Film Beine zu machen: beide beharren - mit Ausnahme einer langen, langen Kampfszene - auf ihrer Behäbigkeit. Im letzten Jahr hat man die Berlinale-Zuschauer mit dem wirr-langweiligen japanischen "Thriller" "KT" gequält, in diesem Jahr wird einem das japanische Kino durch die nicht unsympathische, aber reichlich schlichte Schmonzette vom "Twilight Samurai" verleidet. Dabei gehört Japan immer noch zu den aufregendsten Filmländern der Welt, davon kann man sich in Deutschland auf dem alljährlichen Frankfurter "Nippon Connection"-Festival überzeugen. Die Berlinale vermittelt kaum einen Eindruck davon. Es formt sich der etwas bösartige Wunsch, es möge Takashi Miike mit einem seiner Blutbäder hineinfahren in all das Kunstgewerbe des Wettbewerbs und bürgerliche Seelenqual wie gut gemeinten Biedersinn einfach mal kurz und klein hacken. ... Link Donnerstag, 13. Februar 2003
Wolfsburg (Christian Petzold, D 2003)
knoerer
12:09h
Die erste Szene: ein Mann in einem Auto, am Telefon seine Frau, sie streiten sich. Sie legt auf, das Handy fällt zu Boden, der Mann hebt es auf, ist abgelenkt, ein Schlag. Er hat einen Jungen überfahren, er zögert einen Moment und er fährt weiter. Aus dieser in ihrer scheinbaren Einfachheit meisterhaften ersten Szene entwickelt Christian Petzold seinen Film. Autos, Liebe, der Unfall, die Schuld, so präzise platziert wie unaufdringlich bestimmen diese Motive den weiteren Verlauf. Der Junge wird sterben, wenig später, im Krankenhaus. Der Verlust verwundet, beinahe tödlich, die Mutter, Laura (Nina Hoss, kaum wiederzuerkennen mit schulterlangem dunklen Haar) – aber auch Philip (Benno Fürmann), den Täter, der mehrmals kurz davor ist zu gestehen, der Polizei erst, dann seiner Frau. Es kommt nicht dazu. Er beginnt, sich Laura zu nähern, begegnet ihr, folgt ihr, rettet sie sogar aus dem Fluss. Sie ist von der Brücke gesprungen. Alles setzt er aufs Spiel, seine Ehe, seinen Job. Er versucht, gutzumachen, was nicht gutzumachen ist, zu sühnen – und Laura zu helfen. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Unversehens gerät er so, geraten sie beide in eine Beziehung, an der nicht alles falsch ist, aber das Entscheidende: ihre Voraussetzungen. Petzold erzählt das, wie man es von ihm kennt. Nüchtern, in Einstellungen, die sich auf die Figuren, die Gesichter konzentrieren und ihren Ort im Raum. Es wird nicht viel gesprochen, spröde Sätze nur, die Annäherung zwischen Philip und Laura vollzieht sich nach und nach. Was sie fühlen, müssen wir ihnen ansehen, die Figuren leben aus dem, was uns verborgen bleibt. Das tut unendlich wohl nach allen krampfhaften Motivierungsversuchen, denen man sich eine Woche lang ausgesetzt gesehen hat, nach all dem zu viel und zu deutlich Gesagten. Und Balsam für die Seele auch die Stille, der Verzicht auf Musik die meiste Zeit. Einmal nur, zwischendurch, weht verzerrte Orgelmusik von irgendwo her. Erst am Ende, das man wohl als Erlösung sehen muss, als eine Sühne, die nicht ausbleiben kann, zweimal (wie in Chéraus „Son Frère“), und umso wirkungsvoller, Musik, die nicht untermalt, nichts erzwingt, sondern ganz im notwendigen Pathos der Situation aufgeht. Christian Petzold ist ein Regisseur, dessen ungeheure filmische Intelligenz in den Bildern steckt, in den Figuren, im kunstvollen Einsatz unscheinbarer Motive – und in der Erzählstruktur. Klüger kann man seine Ellipsen nicht setzen: eine Reise nach Cuba, die wichtig ist, wird nicht gezeigt. Es ist das, diese Auslassung, das ausgefallene und gerade darin überzeugende Bild für eine Ehe, eine Beziehung, die am Ende ist. Kein Schnitt auch, in der Anfangsszene, auf die Frau zu Hause. Diese Details sind es, an denen sich der Meister zeigt. Einmal ist Philip in der Nahaufnahme im Bild, er fährt, auf dem Rücksitz zieht Laura sich um, sie ist auf dem Weg zur Arbeit. In der Unschärfe fast sieht man im Rückspiegel seinen Blick, kurz nur, auf Laura. Petzold denkt nicht daran, hier etwas zu unterstreichen. Er kommt dem Zuschauer nicht entgegen. Er setzt auf seine Intelligenz, und das zahlt sich aus. Es gab, neben „Son Frère“, keinen Film auf der Berlinale, der mit so reinen Mitteln großes Kino ist. Um den Verstand einer Auswahlkommissin, die „Wolfsburg“ ins Panorama gesteckt hat, ist zu fürchten. ... Link Mittwoch, 12. Februar 2003
PTU (Johnnie To, Hongkong 2003)
knoerer
16:00h
Johnnie To ist der Tausendsassa unter den Regisseuren Hongkongs. Gemeinsam mit seinem engen Freund und Mitarbeiter Wai Ka-Fei hat er in den neunziger Jahren die Produktionsfirma Milky Way Images gegründet, die seither mit schöner Regelmäßigkeit höchst erfolgreiche Blockbuster hervorbringt, viele davon unter der Regie von Johnnie To und Wai Ka-Fei. Manche dieser Filme - etwa der Hit "Needing You" aus dem Jahr 2000 - sind mit großer Präzision für den breiten Markt gefertigte Kommerzprodukte unterschiedlichster Genres. Daneben aber erlaubt sich To, wann immer es geht, eigenwilligere Filme, mit denen er die festen Regeln des Hongkong-Action-Kinos innovativ umwendet oder gar unterläuft. Sein Meisterwerk "The Mission" (2000) ist einer dieser Filme, eine Studie des Leerlaufs von Action-Helden, nicht ihrer Aktionen. Mit "PTU", seinem neuesten, im Forum der Berlinale als Weltpremiere gezeigten Film, entfernt sich To weiter denn je von den stilisierten Hongkong-Epen, deren Meister er ist - noch im letzten Jahr war in Berlin sein fulminanter "Fulltime Killer" zu bewundern. Im Zentrum steht die Polizei in Hongkong, PTU ist der Name der uniformierten Streifenbeamten, die stets in größeren Gruppen unterwegs sind. Seinen Ausgang nimmt der Film allerdings in einer mit Sinn für absurde Komik inszenierten Szene in einem Billigimbiss, in der nicht nur einer der Protagonisten - der Zivilpolizist Lo, ein arroganter, fetter Kerl - vorgestellt wird, sondern auch eine Gang von Jugendlichen um den Anführer Ponytail (der allerdings bald einen langen und blutigen Tod findet). In der Platzverteilung an den Tischen werden mit leichter Hand Hierarchien entworfen und es wird, unterbrochen von ständigem Handyklingeln, eine Dynamik in Gang gesetzt, die erst mit dem Ende des Films, viele elegant in die Hongkonger Nacht gemalte Bewegungsstudien später, in einen Showdown mündet, ein Entladung, auf die erst einmal nur Stillstand folgen kann. Es sind verlorene, gesuchte, zirkulierende Objekte - eine Waffe, Handys -, die den Plot des Films in Gang halten. Lo hat im Kampf mit Ponytails Gang seinen Polizeirevolver verloren, eine Gruppe von PTU-Polizisten, angeführt von einem Freund, hilft ihm bei der Suche. Sind sie bis zum Morgen nicht erfolgreich, ist der Verlust zu melden, Lo kann seine Beförderung vergessen. Das ist der eine Anlass für die Gänge durch die Nacht, denen To hier folgt. Der andere ist, konventioneller noch, die Suche nach dem Mörder Ponytails. Triaden-Bosse kommen ins Spiel, und PTU, Lo und die im Mordfall ermittelnde Polizistin laufen sich bei der Suche nach Spuren, Tätern und Objekten ein ums andere Mal über den Weg. Dies ist der Plot, mehr als Voraussetzung ist er nicht für das, was Johnnie To hier will. Das ist ein Porträt der überaus ambivalent gezeichneten Polizeitruppe zum einen, ein Porträt der nächtlichen Straßen zum anderen. Wie "The Mission" ist "PTU" ein Meisterwerk der Konzentration: auf einen eng umgrenzten Handlungs- und Zeitraum. Höchst erstaunlich eine mehrere Minuten andauernde Szene, in der die Polizisten sich vorsichtig, Taschenlampe und Waffe im Anschlag, Stockwerk um Stockwerk eines Treppenhauses nach oben bewegen. To macht daraus einen Film für sich, mit Blicken in angespannte Gesichter, kurze Schockmomente. Dramaturgisch bringt diese Szene die Geschichte nicht voran - dasselbe gilt für die meisten Höhepunkte von "PTU". Etwa ein Kind, das auf einem Dreirad durch die Nacht radelt. Stets ist zuerst das leise surrende Geräusch der Bewegung zu hören. Es ist von einer Eindringlichkeit, die nichts mit Bedeutung zu tun hat, sondern beinahe reine Musik ist. Ohne alle Aufdringlichkeit entwickelt die Tonspur nicht nur hier ein Eigenleben: minutenlang wummert dumpfe Musik aus einem nächtlich belebten, nach außen aber ganz verschlossenen Musikpalast. Dieses Ineinander von Haupt- und Nebensachen entfaltet auf die Dauer großen Zauber. Auch die Bilder stehen, zu keinem Zusammenhang genötigt, für sich, als Schritt- und Schnittfolge von Schritten auf Asphalt, immer wieder zeigt To die Polizisten in der Reduktion der Action auf reine Bewegung. Das besitzt Eleganz ohne alle Stilisierung, Johnnie To gelingt das kleine Wunder, der Form, die alltäglich daherkommt, eine seltsame Poesie zu entlocken. Es fragt sich, wenn man diesen wunderbaren Film sieht, nur eines: Warum läuft er im Forum, warum, zum Teufel, soll das nicht gut genug sein für einen Wettbewerb, in dem sich in diesem Jahr die mediokren Werke um die hinteren Plätze schlagen? Klar, es fehlt der bildungsbürgerliche Kunstanspruch, der die Türen zum Wettbewerb stets mit unerträglicher Leichtigkeit aufstößt. Und klar, einer wie Johnnie To kann sich einen Film nur leisten, indem er im Hauptberuf die Filmindustrie Hongkongs am Laufen hält, mit nicht weniger als sieben Filmen, die er während der mehrjährigen Arbeit an "PTU" gedreht hat. Er erzählt das im kurzen Gespräch nach dem Film, ein so freundlicher wie selbstbewusster Herr mittleren Alters, mit Brille und Bauch. Nichts gegen George Clooney, aber mein Held ist sehr viel eher Johnnie To. ... Link
Lichter (Hans-Christian Schmid, D 2003)
knoerer
15:59h
Bisher hat Hans-Christian Schmid - der Regisseur von "Nach fünf im Urwald", "23" und "Crazy" - vor allem Geschichten vom Erwachsenwerden erzählt, und dabei, ganz nebenbei, ein Porträt der Bundesrepublik in drei sehr unterschiedlichen, auch unterschiedlich heiteren Teilen entworfen. Mit seinem jüngsten Werk, "Lichter", ist er nun selbst erwachsen geworden, oder hat sich jedenfalls das Erwachsenwerden verordnet. Ein schwieriger Prozess, davon kündet nun, leider, auch der Film. Vor drei Jahren zog Schmid, der in Bayern aufgewachsen ist und lange Jahre in München lebte, nach Berlin. An der deutsch-polnischen Grenze hat er den Schauplatz seines neuen Films entdeckt. Eine Stunde, nicht mehr, liegt Polen von Berlin entfernt. Angesiedelt ist Schmids Episoden-Drama in der geteilten Grenzstadt Frankfurt (Oder)/Slubice, deren deutsche Seite dem internationalen Publikum bereits aus Andreas Dresens letztjährigem Berlinale-Erfolg "Halbe Treppe" vertraut ist. Zwar hat Schmid auch in seinem neuen Film nicht auf jugendliche Darsteller verzichtet. Und dass er so famos wie kaum ein anderer deutscher Regisseur mit ihnen umgehen kann, zeigt sich erneut. Jedoch bleibt den jugendlichen Zigarettenschmugglern, von denen er erzählt, einfach zu wenig Luft zum Atmen, zu wenig Raum, in dem sie sich ohne Knebelung durch die Geschichte entfalten könnten. Das wiederum liegt daran, dass ihnen nur eine von fünf bis sechs Episoden gewidmet ist, die in "Lichter" lose miteinander verknüpft werden, zeitlich auf zwei Tage und räumlich (beinahe) auf Frankfurt (Oder), Slubice und Umgebung beschränkt. In weiteren Episoden geht es unter anderem um einen Trupp ukrainischer Flüchtlinge, die nicht, wie gehofft, in Berlin, sondern auf der polnischen Seite der Grenze aus dem Wagen geworfen werden, außerdem um einen deutschen Matratzenhändler im geschäftlichen Unglück und um einen jungen deutschen Architekten, der entdeckt, dass seine polnische Ex-Freundin jetzt anschaffen geht. Solche ineinander verschachtelten Episodenfilme sind immer eine höchst heikle Angelegenheit, da sie ebenso nach Rhythmusgefühl verlangen wie nach einem Gespür für den Zusammenhalt im Ton und einem geschärften Sinn für Kontraste. An allem mangelt es Schmids Film. Allzu hektisch schneidet er von einer Geschichte zur anderen. Die ständig wackelnde Handkamera des polnischen Kameramanns bleibt zwar nah an den Figuren, verhindert aber jeden Moment der Konzentration. Das eigentliche Problem von "Lichter" liegt jedoch in den einzelnen Episoden selbst. Es ist ihnen deutlich anzumerken, wie viel gefeilt und getüftelt wurde - solange bis die bisher bei Schmid so wunderbare Beiläufigkeit sich ins Illustrative gewendet hat. Zu viel Arbeit am Drehbuch ist hier der Figuren Tod. Es hilft auch nichts, dass die Geschichten und die Charaktere um die zwei Leitmotive "Geld" und "Grenze" gruppiert werden. Deutlich wird dadurch nur, wie fest Schmid plötzlich an die Möglichkeit von Wirklichkeitsbeschreibung in Form gerundeter Geschichten glaubt. Da war er schon mal weiter. ... Link
Blinder Schacht (Li Yang, Hongkong, China, D 2002)
knoerer
15:58h
Song und Tang, zwei Freunde, haben eine hübsche kleine Geschäftsidee. Schließlich ist jetzt Kapitalismus in China, und man tut, was man kann. In der Stadt gabeln sie Arbeitslose auf, versprechen ihnen einen Job im Bergbau und geben sie dort dann als enge Verwandte aus, der Bruder, der Neffe, wie es kommt. Ein paar Tage später gibt's einen Schlag auf den Kopf, das lässt sich problemlos als Folge eines eingestürzten Stollendachs ausgeben. Die Besitzer der Minen betreiben ihr Geschäft, versteht sich, ohne Rücksicht auf irgendwelche Sicherheitsvorschriften und zahlen an die vermeintliche Verwandtschaft Schweigegelder. Song und Tang leben gut davon, eine veritable kleine Wir-AG, ganz die Sorte pfiffigen Unternehmergeists, an der anderswo tief gefühlter Mangel herrscht. Es versteht sich von selbst, dass Regisseur Li Yang zunächst einmal eine Karikatur der Verhältnisse im heutigen China zeichnen will, die die Wirklichkeit ins Erkennbare entstellt. Es ist interessant, dass Song und Tang dem Zuschauer vom ersten Bild an nicht als grausame Mörder vorkommen wollen, sondern als im Grunde ganz nette Kerle, die von den Verhältnissen gezwungen werden, krumme Wege zu gehen. Das weiche Herz des einen wird, ganz folgerichtig, beiden dann zum Verhängnis. Ihren ersten Mord handelt der Film noch kurz, knapp und trocken ab, um sich dann auf das nächste anvisierte Opfer zu konzentrieren: den 16-jährigen Yuan. Nicht nur Song, sondern auch dem Zuschauer wird er schnell sympathisch, naiv wie er ist und voller Ehrgeiz, das Schulgeld aufzutreiben in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. "Blinder Schacht" ist eine exemplarische Geschichte und doch zugleich von einer Genauigkeit, die fast dokumentarisch anmutet. Die Herkunft des Regisseurs vom Dokumentarfilm wird deutlich in den Bildern aus der Stadt, in der die Mörder ihren Schützling in ein Bordell schicken - er soll nicht als Jungfrau sterben -, und in den Bildern, die die brutalen Bedingungen zeigen, unter denen die Bergwerksarbeit stattfindet. Schmutzig ist die Baracke, in die die drei gesteckt werden, notdürftig überkleben sie die Wände voller ausgebleichter Pin-Up-Poster mit Zeitungspapier. So finster die Umstände sind, die "Blinder Schacht" schildert, so objektiv zynisch die Lage der Dinge ist: Von gelegentlichen Überdeutlichkeiten abgesehen, macht der Film nicht zu viel Aufhebens davon. Er funktioniert als emotionale Geschichte im kleinen Format wie als dokumentarischer Einblick in ein China, dessen brutale Transformation in eine kapitalistische Gesellschaft im Westen weitgehend unbekannt bleibt. Mit den nicht nur finanziell, sondern gewiss auch ästhetisch beschränkten Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, wirft Li Yangs Film ein Schlaglicht auf das heutige China. Ein kleiner Film, aber durchaus das, was man sich von einem als politisch deklarierten Festival erhoffen darf. ... Link Dienstag, 11. Februar 2003
Lichter (Hans-Christian Schmid, D 2003)
Reuthebuch
22:47h
Als Einschub zu Ekkehard Knörers Kritik, die ich in Gänze nachvollziehen kann, möchte ich insbesondere auf die Stilistik des Films eingehen. Was zu Beginn des Films, bei der Einführung der Figuren, noch wunderbar funktioniert, nämlich die Konzentration auf das Wesentliche der Szenen, das Prinzip der Auslassung also und ich spreche jetzt ausschließlich von der Arbeit am Schneidetisch, gerät später zu einem entscheidenden Nachteil der auf das Grundproblem des Films verweist. Nichts wird, so hat man den Eindruck, ausgespielt, alles bleibt fragmentarisch. Die Intuition und das Rhythmusgefühl, das die Entstehung von Musik bedingt, ohnehin auf den Film übertragbar, sind beim Episodenfilm von entscheidender Bedeutung. Unabhängig von der Funktion der Szene, und den Befindlichkeiten der in ihr agierenden Darsteller, wird bei "Lichter" von vorne bis hinten die Dynamik, die die Szene auf ihren Höhepunkt zutreibt, über das intuitiv gefühlte Tempo gestellt. Das führt wiederum zu dem Empfinden von Distanz gegenüber den Figuren. Die pessimistische Lesart, die in Wortmeldungen während der Pressekonferenz anklang, ist deshalb doppelt gerechtfertigt. Man zwingt nicht nur etwa den Figuren ihre Entscheidungen auf, das ökonomische Gefälle zwischen Ost und West und so weiter, sondern traut auch sich selbst als Filmemacher nicht über den Weg. Die Ratio triumphiert über die Intuition. Insgesamt bleibt die Hoffnung, dass dem einen Schritt zurück, zwei nach vorne folgen. ... Link
Science Fiction (Franz Müller, Deutschland 2003)
Reuthebuch
21:43h
Der Ostdeutsche Kleingewerbler Jörg (Arved Birnbaum) hat Probleme. Nach dem Mauerfall liefs im Osten schlecht, 1992 zieht er in den Westen, da läufts noch schlechter, was tun? Die erste Sequenz des Films zeigt ihn, unterwürfig, ohne Scheu noch vor der grausamsten Selbsterniedrigung, in einem grotesken Motivationsseminar. Von Seminarleiter Marius (Jan Henrik Stahlberg), einem abgezockten Zyniker mit diabolischen Zügen, gnadenlos vor versammelter Mannschaft vorgeführt, tut sich plötzlich ein Riss im Zeit-Raum Kontinuum auf, in das die beiden ungleichen Herren fallen. Auf der anderen Seite landen sie in einem Paralleluniversum, in dem sie ohne jegliche Konsequenzen schalten und walten können. Schließt sich zwischen unseren Helden und dem Rest der Welt nämlich eine Tür, beginnt alles wieder von vorne. Eine Allmachtsphantasie, die frei nach der im Seminar von Marius propagierten Theorie der "Mental Syntax" (Der Eimer ist die Form, das Wasser der Inhalt), als Grundkonstellation für alles und nichts dient. Was stellt man jetzt damit an? Frank Müller hat sich für die denkbar konventionellste Methode entschieden. Er spielt wie in einer Versuchsanordnung die komischen Aspekte des Stoffes gegen das Potenzial seiner Geschichte aus, bis man durch die Redundanz des Konzepts bedingt am toten Punkt ankommt und auf die "Deus ex Macchina" des Unterhaltungskinos zurückgreifen muss: die alles überwindende Kraft der Liebe. Das kann man bedauern, vielleicht muss man das sogar; immerhin funktioniert die Geschichte, auch wenn es zwischendurch mächtig holpert. Großen, wenn nicht entscheidenden Anteil daran hat Jan Henrik Stahlberg in der Rolle des Marius, der in seinen besten Momenten zwischen seiner teuflischen Boshaftigkeit die Fragilität seiner Figur durchblitzen läßt. Ein schöner Einfall des Drehbuchs ist es auch, am Ende seine Erlösung in den Mittelpunkt zu rücken und nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, den drögen wenn auch liebenswerten Jörg. Mit dem Bewußtsein, dass es sich hier um eine Erstlingswerk handelt, sieht man da auch wohlwollend über die mißratene Einführung der Liebesgeschichte und die fallengelassenen Ost-West Bezüge hinweg. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8770 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

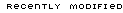
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||