
 |
... Vorige Seite
Freitag, 7. Februar 2003
In this World (Michael Winterbottom, GB 2002)
knoerer
12:06h
Glückwunsch zur Programmierung, Herr Kosslick. Stärker hätte der Kontrast zwischen dem außer Konkurrenz laufenden Eröffnungsfilm und dem ersten richtigen Beitrag zum Wettbewerb nicht ausfallen können. Wo „Chicago“ sich ohne alle Reue in Kunstwelten tummelt, hartschalig abschließt gegen alles, was mit der Realität außerhalb von Song-and-Dance zu tun haben könnte, unternimmt der britische Regisseur Michael Winterbottom mit „In This World“ das gerade Gegenteil. Sein Film erzählt die Geschichte einer Reise, die in Peshawar an der pakistanischen Grenze ihren Ausgang nimmt und die Cousins Enayat und Jamal (der, gerade mal sechzehn Jahre alt, nur mitkommt, weil er Englisch spricht) ins gelobte Land, genauer: nach London führen soll. Dünn ist die Linie zwischen Realität und Fiktion. Die Reise, von der der Film berichtet, haben Winterbottom und sein kleines Team tatsächlich unternommen, die beiden großartigen Hauptdarsteller wurden in Pakistan gecastet, viele der Szenen auf den Straßen von Peshawar, Teheran und Istanbul haben dokumentarischen Charakter. Dazu trägt die Digitalkamera bei, mit der man gedreht hat, in gelbstichigen, wackligen Bildern, die sich gelegentlich ins beinahe Unentzifferbare auflösen, in schwarz-weißes Gegrissel etwa beim Grenzübergang vom Iran in die Türkei. Ein Dokumentarfilm ist „In This World“, der ersten Anmutung zum Trotz, jedoch mit aller Entschiedenheit nicht. Zweimal meldet sich aus dem Off ein Sprecher erläuternd zu Wort, danach spricht das Gezeigte für sich. Die Bilder aber, die Szenen, die Figuren werden in die Struktur des Road Movie eingefädelt, mit vorgegebenen Dialogen, Auslassungen, Spannungsmomenten – entlang einer zur Orientierung regelmäßig eingeblendeten Karte, auf der die Route eingetragen ist. Dazu kommen Ortsangaben, in großen Lettern wie auf die digitalen Bilder getüncht, aber rissig, durchlässig für die Landschaften, die zu sehen sind. Dies Verhältnis von Vorder- und Hintergrund kennzeichnet Winterbottoms Verfahren im ganzen: in die Szenerie der Wirklichkeit wird die fiktive, aber nach wahren Begebenheiten modellierte Erzählung wie al fresco eingetragen. Der Raum der Fiktion schließt sich um den dokumentarischen Kern, mit allen Konsequenzen. Der Betrachter ist aufgefordert zum Mitfiebern wie zum Mitleiden, nicht zuletzt durch die Musik. Ohne Zurückhaltung untermalt Winterbottom seine Bilder mit emotionalen Orchesterklängen, verstreicht die Momentaufnahmen ins Flächige eines Nacheinander, das keine Längen kennt. Das heißt auch: von der Erfahrung, die geschildert wird, von Stunden, Tagen, Wochen des Ausgeliefertseins, des Nichtstuns und des Nicht-Weiter-Wissens, die eine solche Flucht ausmachen, gibt es nur Auszüge, Andeutungen und Ahnungen. Das ist kein Fehler des Films, denn er behauptet nirgends, dass mehr zu zeigen wäre als Annäherungen ans Unbegreifliche eines solchen lebensgefährlichen Unternehmens. Dezent bleibt die Kamera in den finstersten Momenten – die in Wahrheit Ewigkeiten sind, während der Überfahrt per Schiff von der Türkei nach Triest. Tagelang sind Jamal, Enayat und weitere Flüchtlinge, darunter ein Baby, eingesperrt in einen finsteren Container, ohne Nahrung, Wasser, frische Luft. Andere Bilder aber als ein gelegentliches Flickern, sekundenkurze Blicke in gequälte Gesichter zeigt der Film nicht. Auf alle Ausbeutung der Schicksale, von denen er erzählt, verzichtet er. Und berührt doch, gerade durch die Selbstverständlichkeit, mit der er vorgeht. Zu sehen sind nicht nur Bilder aus fremden Welten, sondern auch die im Verlauf der Reise fürs westliche Auge zunehmend vertrauten Umgebungen werden unterm Blick der Migranten plötzlich fremd. Und wie von selbst wird einem klar, was, wie Winterbottom unumwunden feststellt, von Anfang an die Botschaft seines Projekts gewesen ist: Kalten Herzens von Elendsflüchtlinen zu reden, die so eilig wie möglich auszuweisen sind, ist ein Wohlstandszynismus, der nichts als Verachtung verdient. Am Ende übrigens, ist in der Pressekonferenz zu erfahren, hat die Realität den Film dann endgültig eingeholt: Jamal, der nach Ende der Dreharbeiten in seine Heimat zurückgekehrt war, hat die Flucht gewagt, lebt nun mit außerordentlicher Duldung in London und wird am Tag vor Vollendung seines 18. Lebensjahrs abgeschoben werden. ... Link Donnerstag, 6. Februar 2003
Forum: Edi
Reuthebuch
21:40h
Edi ist der erste Spielfilm des knapp 40-jährigen Polen Piotr Trzaskalski und der Film macht Lust auf mehr, soviel sei schon zu Beginn gesagt. Mit wenigen Strichen wird eine Geschichte skizziert, die geradlinig seine Hauptfigur in furchtbare Verwicklungen führt, sie befreit, herumwirbelt und wieder an den Ausgangspunkt zurückkatapultiert. Edi und sein Freund Jureczek leben in Warschau in ärmlichen Verhältnissen in einer Lagerhalle. All das was die besser gestellten der polnischen Hauptstadt achtlos wegwerfen, sammeln die beiden ein und machen es zu Geld. Die paar Kröten werden dann im Handumdrehen in einer Spelunke in Alkohol umgesetzt. Edi ist in diesem Milieu ein Sonderling, jemand der selten den Mund aufmacht und Bücher in Unmengen verschlingt. Jemand, der zwei dubiosen Alkoholhändlern weltfremd genug erscheint, als dass sie ihm ihre 17-jährige Schwester anvertrauen. Edi soll ihr bei den Schularbeiten auf die Sprünge helfen. Kurz darauf ist sie schwanger. Trzaskalski, der auch das Buch schrieb, braucht nach dieser Exposition nur wenige Szenen, um die komplexen Beziehungen zwischen seinen Figuren zu entwickeln. Aus Angst um die Entdeckung ihres Freundes, beschuldigt das Mädchen Edi der Vergewaltigung. Wenig später machen ihre Brüder kurzen Prozess, verstümmeln zunächst Edis Männlichkeit, um ihm 9 Monate später den "Bastard", das unwürdige Baby der Schwester, in die Hand zu drücken und ihn aus der Stadt zu treiben. Edi, Jureczek und das Kind landen schließlich mittellos auf dem Land, bei Edis Exfrau und deren Mann, der damals, so klingt es an, nicht nur Edis Frau, sondern dessen gesamtes Leben "gestohlen" hat. Was nach einem trostlosen Trauerspiel klingt und Erinnerungen an schwer durchzustehende Berlinalebleigewichte wie etwa Fred Kelemens "Frost" weckt, gerät Trzaskalski zu einer Studie über Lebensmut und Zivilcourage. Im ersten Drittel des Films fragt der überforderte Jureczek seinen Freund, warum zum Teufel er ständig seine Nase in diese vermaledeiten Bücher stecken würde, die ihm doch offensichtlich keinen Zloty einbrächten. Knapp entgegnet Edi, das sie ihm etwas viel wichtigeres einbrächten: inneren Frieden. Später schenkt er einem kleinen Jungen ein Spielzeugauto. Ja aber, fragt Jureczek, heute sei doch gar nicht Weihnachten? Weihnachten ist immer dann, entgegnet Edi trocken, wenn man es will. Das sind bei Trzaskalski nie Plattitüden sondern vielmehr aus genauer Beobachtung entstandene, treffende Beschreibungen einer Haltung, die der Aggressivität des Umfelds die einzig richtige Antwort zu geben scheint. Mit der neuen Aufgabe, der Sorge um das ungewollte Kind, gelingt ihm sogar die Bewältigung seiner Vergangenheit und im Schoß der neugefundenen, zusammengewürfelten Großfamilie auf dem Land, die Erfahrung von Glück und Liebe. Als sich in der Stadt die Verhältnisse geklärt haben freilich, bricht die "Realität" in Form des protzigen BMWs in die Idylle ein. Edi verliert abermals alles und landet am Ende wieder dort, wo alles begann. Auf den Straßen Warschaus, mit einer kleinen Karre voller Schutt. Jureczek trottet neben ihm her, verzweifelt, will wissen wozu ihr Leben denn noch gut wäre. Edi antwortet unverzagt: es ist unseres. ... Link
Chicago (Rob Marshall, USA 2002)
knoerer
16:26h
Die ersten Bilder sind ein Statement: Musik ist Sex, Sex ist Musik sagen sie, Bühne und Bett werden ruck-zuck ineinander geschnitten. Allerdings zeigt sich sogleich: Sex ist nicht gut genug, dran glauben muss der Mann, Frank Caseley sein Name, der Roxie Hart (Renée Zellweger) Verbindungen zum Showbusiness versprochen hatte, um sie ins Bett zu bekommen. Roxie nämlich träumt vom Erfolg als Revue-Star – und als diese Träume plausibilisiert der Film, ein wenig überflüssigerweise, seine Musikeinlagen. Der Schwindel jedoch fliegt auf, Verbindungen gibt es keine, Roxie greift zur Pistole und erschießt Caseley - beinahe kann sie ihren Mann, den reichlich tumben Amos (John C. Reilly), noch überreden, einen Meineid zu schwören, um ihr Leben zu retten. Und schon das erste Gespräch, die Aufnahme der Beweise an der Stätte des Verbrechens, ist inszeniert als Fortsetzung von Roxies Traum, eröffnet den doppelten Schauplatz, auf dem sich «Chicago» bis zum Ende aufhalten wird. Es durchdringen sich die rauhe (naja, nie allzu rauhe) Wirklichkeit, der Streit mit Amos - gleich geht es dann ab in den Knast - und die Traumwelt der Musicalbühne, auf der das Leben nichts ist als eine rasante, bunte Show. Hier rückt Marshall beides ins selbe Bild, links die Bühne, rechts die Wirklichkeit, ähnlich geht es immer weiter. Sei es im Schnitt, in scheinbar kontinuierlichen Kamerabewegungen, die von einer Ebene auf die andere schwenken: hauchdünn und durchlässig ist in diesem Film die Grenze zwischen der einen Welt und der andern, da gibt der tropfende Wasserhahn in der Gefängniszelle den Rhythmus vor und von selbst öffnet sich das Gitter der Zelle für die Shownummer von den sechs Mörderinnen. Die Konsequenz, die dieses Ineinander hat, ist nicht, wie vielleicht zu erwarten, dass etwa das eine das andere kommentiert, so dick auch der Geschichte eine Moral auf die Stirn geschrieben steht. Die läuft darauf hinaus, dass Recht und Gesetz und Mord und Totschlag in Chicago einfach Teil des Showbusiness sind, ein großer Spaß, das eine führt zum andern. Ihre Verkörperung findet diese Moral im Anwalt Billy Flinn, den Richard Gere mit aller ihm zur Verfügung stehenden Großkotzigkeit gibt. Und verdankt ist sie, die Moral, gewiss der Herkunft des Musicals aus den zwanziger Jahren, in denen es ein Theaterstück war, bevor es erst in Filme mutierte (einer davon, ohne Musik und Tanz übrigens, mit Ginger Rogers), dann auf dem Broadway Triumphe feierte unter der Regie des legendären Bob Fosse. All das aber scheint Rob Marshalls Film so herzlich egal wie die Geschichte, die er erzählt, einen Tod durch den Strang inklusive. Auch der wird schwupp-di-wupp auf die Bühne gebracht als unter Trommelwirbel vorgeführte Kunst des Verschwindens. Nein, Marshall hat nichts im Sinn als Musik und Tanz, inszeniert mit staunenswerter Eleganz seine Nummern und verschneidet sie mit dem einen oder anderen Versatzstück aus dem Frauen-Gefängnisfilm zu harmlos-bunter Unterhaltung. Verlass ist dabei auf die Stars, wobei die blonde Renée Zellweger ohne große Mühe Catherine Zeta-Jones als Velma Kelly überstrahlt, Showbiz-Konkurrenz unter Killerinnen, mit Startvorteilen für Kelly als einstigem Bühnenstar. Der aber gebricht's am wahrhaft atemberaubenden Intrigentalent Roxies, sie zieht den kürzeren, nicht nur in der Gunst des Anwalts Billy Flinn. Beiden zur Seite steht als mütterliche Gefängnisaufseherin Queen Latifah, auch sie macht ihre Sache nicht schlecht. In seinen selbst gesteckten Grenzen lässt «Chicago» in der Tat nicht viel zu wünschen übrig; die Musik ist schmissig, die Choreografien sind umwerfend - und dass der Film drei Golden Globes erhielt, spricht auch für sich. Ein Jenseits dieser selbst gesteckten Grenzen schierer Unterhaltung aber gibt es nicht. Die Virtuosität ist sich genug und immer wieder, da das Tempo hoch genug ist, die Einfälle in schneller Folge überraschen, verlangt man gar nicht mehr. Kaum wagt man zu fragen, ob nicht vielleicht nur bonbonbunte Besinnungslosigkeit hinter dem „Razzle-Dazzle“ steckt, das die Sinne verwirren will, mehr nicht. Oder ob nicht gar das ganze im Grunde ein zynisches Spiel mit einer Moral ist, die der Film zum Schein sich auf die Fahnen schreibt. Womöglich aber ist das alles gar nicht wichtig und "Chicago" einfach als das leckere, aber nicht sehr gehaltvolle Hors'd'oeuvre zu nehmen, als das Kosslick es wohl auch gemeint hat. ... Link
Berlinale
knoerer
10:53h
Es ist wieder so weit. Für die Dauer der Berlinale wird das Weblog umgewidmet zum Festival-Blog. Kaum gesehen, werden die Filme auch schon besprochen. Hier. Ab sofort. Mehr, jetzt schon, auf der Startseite bei Jump Cut. ... Link Montag, 3. Februar 2003
knoerer
16:59h
Jörg Lau hat recht, Wort für Wort. Nicht immer, aber hier schon. ... Link Sonntag, 2. Februar 2003
Blog Bush War
knoerer
10:10h
Buch um Buch gegen Bush schreibt Douglas Kellner - bei dem ich mal Seminare besucht habe, damals, in Austin, als gerade der kleine Bush dort zum Gouverneur gewählt wurde und man's nicht fassen wollte (in Austin selbst hat er auch kein Bein auf den Boden bekommen, aber leider ist Texas ja groß und weit). Sehr umtriebiger Kerl, Kellner jetzt, zwanzig Jahre lang im Public Television aktiv (so eine Art offener landesweiter Kanal), der Nachlassverwalter Marcuses, Verfechter einer mit Fredric Jameson marxistisch gedachten Postmoderne-Kritik. Die Sorte, die im Hörsaal barfuß auf dem Pult sitzt und immer unterhaltsam von links her über die Missstände der Gesellschaft schwadroniert. Habe ein Adorno-Oberseminar bei ihm gemacht, das hätte zwar gelegentlich auch Teddy die Schuhe ausgezogen, was Kellner da so verzapfte, aber seltsam genug war's schon, da in Texas auf Englisch über nun ausgerechnet Adorno zu diskutieren. Wie ich darauf komme: eher so. Aber auch, weil ich entdeckt habe, dass Kellner, der inzwischen eine Professur an der UCLA hat, mit Freunden unter dem Titel BlogLeft ein u.a. Anti-War-Blog betreibt. Wie übrigens auch Jerome Doolittle, einstmals Redenschreiber Carters, dann ein Autor von Klasse-Krimis, der Anfang der neunziger seinen Verlag verloren hat und seitdem online publiziert, sich die Seite mit einem der besten US-Krimi-Autoren überhaupt teilt, K.C. Constantine (hab ich, glaube ich, schon mal erwähnt). ... Link Samstag, 1. Februar 2003
Hat ja keinen Sinn
knoerer
18:02h
einen Link zu setzen auf den Artikel, weil FAZ und ratzfatz weg. Festzuhalten bleibt, dass mir Martin Seel - der heute über Autonomie und Karlheinz Bohrer schreibt - ein grundsympathischer Philosoph ist. Liest sich immer ganz unspektakulär und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich dem typischen Philosophenreflex nicht mehr nachgegeben habe zu denken, dass es dann ja wohl nicht ganz satisfaktionsfähig sein kann. Mittlerweile halte ich eher das Gegenteil für richtig: Gerade weil er so nah dran ist an den Dingen, die uns im Alltag umtreiben, und zugleich einen sensiblen und analytischen Blick darauf wirft, Rekonstruktionen betreibt, die nichts sensationell Neues zu Tage fördern, das vage Vertraute aber auf den ans Literarische oft sich anschmiegenden Begriff bringen, gerade drum ist das großartig. Wilde Dinge durch die Gegend denken, ohne sich groß um Rückschlüsse aufs eigene Leben in der Welt zu kümmern, ist leichter als alle Welt glaubt. Und schwerer ist's als die Philosophen meinen, Relevantes über das, was uns betrifft, zu denken, das als Denken etwas taugt. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8770 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

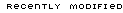
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||