
 |
... Vorige Seite
Sonntag, 9. Februar 2003
The Hours (Stephen Daldry, GB 2002)
knoerer
12:11h
Mit großer Kunstfertigkeit bindet Regisseur Daldry in den ersten Minuten die drei Geschichten zusammen, die „The Hours“ erzählen wird. Er schneidet zwischen drei Welten hin und her, dem Los Angeles des Jahres 1951, dem New York der Gegenwart und dem Jahr 1942, in dem Virginia Woolf Selbstmord begeht. Dreimal ein Blumenkauf, dreimal dieselbe Bewegung, mit der im schnellen Hintereinander filmischer Beinahe-Gleichzeitigkeit Blumen in eine Vase gestellt werden. Äußerst durchlässig sind die Membranen zwischen den Welten, die Kamera, der Blick des Betrachters gleiten hinüber von der einen Seite zur anderen, schwerelos, famos unterstützt noch vom verlässlichsten Schmiermittel, das an zeitgenössischer Soundtrack-Musik zu haben ist, den hypnotischen Minimalklängen von Philip Glass, sehr klavierlastig diesmal, aber erfolgreich in der Produktion einer Atmosphäre, die durch alle drei ineinander geschalteten Teile von „The Hours“ hindurchweht. Wehen aber ist das falsche Wort, denn im Grunde steht die Luft, bei Woolf in England, im Leben der Laura Brown an der amerikanischen West- und in dem Clarissa Vaughns an Ostküste. Erzählt wird, nach dem Vorbild von Virginia Woolfs Roman „Mrs. Dalloway“ (ursprünglich geplanter Titel: „The Hours“) nur ein Tag aus dem Leben der drei Frauen, an diesem einen Tag jedoch, der Film zitiert es wörtlich, ein ganzes Leben. Sehr treu folgt Daldry da seiner Vorlage, Michael Cunninghams Roman, der mit Variationen und Übernahmen Virginia Woolfs Roman in einem cleveren Pastiche umspielte – und dafür den Pulitzer-Preis erhielt. Clarissa Vaughn (im Film: Meryl Streep) verliert den schwulen Dichter, die Liebe ihres Lebens. Laura Brown (Julianne Moore) entschließt sich eines Nachmittags, ihr Leben, ihre Familie für immer zu verlassen, um nicht im kleinbürgerlichen Alltag zu ersticken. Und Virginia Woolf (Nicole Kidman) schreibt an „Mrs. Dalloway“, geplagt von ihren inneren Dämonen. Es ist im Grunde weniger ein Roman als eine Kollektion dreier motivisch verknüpfter Kurzgeschichten, eine Auswahl prägnanter Ausschnitte aus dem Leben der Hauptfigur an einem Wendepunkt ihres Schicksals. So wenig man Cunningham die schiere technische Raffinesse absprechen konnte – so geschmäcklerisch war das Ergebnis. Die Porzellanfiguren, die Charaktere darstellen sollten, waren mit sprachlichem Woolf-Imitat geschmückt, mit allerhand Motivmaterial aus der Vorlage behängt und in ihrem jeweiligen Habitat ausgesetzt. Die Gefühle, die Motive, die Schicksalsmomente: wie in Seidenpapier eingeschlagen, raschelnd, niemals rührend, scheinhaft belebt, aber nicht lebendig. Eine problematische Vorgabe also und leider ist Daldry eine ganz und gar kongeniale Verfilmung gelungen. „The Hours“ ist in Ausstattung und Inszenierung, im Spiel der Darsteller allerbeste Qualitätsarbeit. Das Ergebnis aber ist nicht Kunst, sondern lediglich erlesenes Kunsthandwerk. Alles wirkt hier wie aus zweiter Hand, Imitat eines Originals, das mit höchst liebevoll angefertigten Figurinen nachgestellt wird. Figurinen aber bleiben sie und je größer die Gefühle sein sollen, die aus den Konstellationen entspringen, desto deutlicher wird klar, dass ausschließlich Abziehbilder agieren, die zu der Wirklichkeit, in der der Film sie mit Kostüm und Interieur zu verorten sucht, nicht die mindeste Verbindung haben. Die Gefühle bleiben in den Mund gelegt und ins Zittern der Mundwinkel von Meryl Streep, nicht aus dem Inneren kommen sie, sondern sind auf die Darsteller eines Schicksalsballetts aufgeschminkt, das mit mechanischer Präzision abläuft. Es fehlt dem ganzen nur eine weniges: Lebendigkeit, ein Hauch nur, der aus den Menschendarstellern Menschen gemacht hätte. ... Link Samstag, 8. Februar 2003
Ulrike Mattern über Pater Familia (Panorama)
uma
16:54h
Derweil alle Journalisten über den etwas sechs Sekunden lang zu sehenden Hintern von George Clooney im Wettbewerbsbeitrag „Solaris“ räsonieren, lässt mehr als ein männlicher Schauspieler in dem italienischen Film „Pater Familias“ unbeachtet von der Öffentlichkeit die Hosen runter. Was ist schon das Gesäß eines Neapolitaners gegen das eines Schauspielers aus Hollywood, der mit einem Ferkel zusammenlebt? „Max“, das Hausschwein von George Clooney, schafft qua Geschlecht und Gattung den Übergang zu einem Thema, das in dem Panorama-Beitrag von Francesco Patierno bis zur körperlichen Erschöpfung des Publikums überzeugend dargestellt wird: Männer sind Schweine. Sie lassen ihre Hosen runter, um ihre Ehefrau oder Schwester zu vergewaltigen, die Freundin im Auto oder eine unbekannte Passantin auf der Straße zum Sex zu nötigen oder vom Kontrahenten an dieser empfindlichen Stelle gepackt und verletzt zu werden. Dass Sexualität Macht bedeutet und Vergewaltigung nichts mit Sex zu tun hat, bleibt bei Patierno keine graue Theorie, sondern ist Alltag in einem kriminellen Milieu in Süditalien. „Neapel sehen und sterben“, die pathetische Erinnerung an den pittoresken Charme einer verfallenden Stadt heißt bei dem italienischen Regisseur in der gewalttätigen Gegenwart: in Neapel leben und sterben. Alle sterben, töten, werden ermordet: die Klassenkameraden, Freunde, Verwandte und Bekannte von Matteo, den man am Anfang des Films sieht, wie er auf seine Entlassung aus dem Gefängnis für einen Tag Hafturlaub wartet. Ein schmaler, ernsthafter Mann im ordentlich gebügelten Jackett. Verurteilt für einen Rachemord. Mit dem Bus reist er nach Hause, in den Vorort von Neapel, wo seine Familie lebt. Sein Vater liegt im Sterben, und Matteo will ihn noch einmal sehen. Eine Reise in die Vergangenheit, welche die Kamera mit marmorierten Bildern gegen eine deutlich dargestellte Gegenwart abgrenzt. Ein Bild, vier Jungen, die in langsamen Bewegungen nach und nach eine weißgraue Steinmauer herunter springen, rahmt den Film, taucht immer wieder auf und wird zu Beginn mit Musik unterlegt, die ihm den Anstrich eines MTV-Videos gibt. Diese gefällige Ästhetik verliert sich im Verlauf der Handlung, um kurz vor Schluss wieder aufgenommen zu werden, wenn nur noch einer der Jungen von der Mauer springt. So viel Tristesse, Gleichgültigkeit, Gewalt und lässt sich nur ertragen, weil Matteo und Rosa, seine Jugendfreundin, die Spirale durchbrechen. Am Sterbebett macht der Sohn dem Vater zum Vorwurf, dass er ihn nie geschützt habe. Wenn man den Titel „Pater Familias“ in dem Sinne interpretiert, dass sich das – ansonsten hier als gewalttätig geschilderte – männliche Oberhaupt um die Familie kümmert, übernimmt Matteo am Ende diese Funktion für Rosa und ihre Tochter. Er holt sie aus der arrangierten Ehe mit ihrem gewalttätigen Mann und vertraut sie einer Nonne an. In den letzten Jahren zeichneten sich die meisten italienischen Beiträge auf der Berlinale, insbesondere in den Sektionen Wettbewerb und Panorama, durch die gepflegte Langeweile der Mittelschicht, hysterische Beziehungsdramen oder öde Kostümfilme aus. Diesen Trend hat „Pater Familias“ mit seiner schonungslosen Schilderung der brutalen Realität beendet. ... Link
Adaptation (Spike Jonze, USA 2002)
knoerer
15:44h
Susan Orlean, Journalistin beim „New Yorker“, hat ein Buch geschrieben, über Orchideen. Charlie Kaufman, Drehbuchautor, berühmt für sein Skript zu „Being John Malkovich“, bekommt den Auftrag, es fürs Kino zu adaptieren. Ihm fällt nichts ein. Was tun? Ein Drehbuch schreiben, in dem es um den Drehbuchautor Charlie Kaufman geht, dem zur Verfilmung von „The Orchid Thief“ nichts einfällt. Abgeschmackte Idee. Was tun? Ins Drehbuch einen Zwillingsbruder schreiben, Donald, mit dem man über das Drehbuchschreiben diskutieren, ja, in Konkurrenz treten kann. Man nennt das selbstreflexiv und kann eine ganze Menge Gags draus ziehen, einen Besuch im Seminar eines Drehbuchgurus zum Beispiel, der – ohne alle Selbstreflexivität, versteht sich – genau die Prinzipien vertritt, die uns die stromlinienförmigen Höllenprodukte bescheren, die einem Hollywood sonst so präsentiert. „Adapatation“ ist anders, so viel steht fest. Kein Spannungsbogen, keine vernünftige Drei- oder Sonstwasaktigkeit, statt dessen ein wildes Durcheinander von erzählter Geschichte, Schreiben an der Geschichte und Diskussion über das Schreiben. Am Ende werden dann, wie sich das für den postmodernen Ansatz gehört, die Diskussion und das Schreiben in die Ausgangsgeschichte zurückgefädelt, Donald Kaufman style. Mit Drogen, Waffen, Krokodilen. Man kann sich, das ist der große Vorteil des Kaufmanschen Ansatzes, so manches erlauben, wenn man erst mal klar gestellt hat, dass, was immer man tut, Zitat bleiben wird – und sei es das Zitat eines Verlangens nach Einmaligkeit und Leidenschaft. Irony is over? Von wegen – aber das Problem hat die Stufe erreicht, auf der die Unfähigkeit, nicht ironisch zu sein, zum Problem wird. Ironisch abgehandelt, natürlich. Doppeldeutig ist der Titel, er bezieht sich auf die Drehbuch-Adaption zuerst, dann aber auch auf Darwin. Das kommt, ein wenig, von der Orchideen-Geschichte, mehr aber von Charlie Kaufmans zuletzt in seinem Buch zu Michel Gondrys „Human Nature“ demonstriertem philosophischem Interesse an der Evolutionstheorie. Spike Jonze, Bruder im so ironischen wie cleveren Geiste, illustriert das gerne mal mit einem Videoclip: Vom Anfang der Welt bis Charlie Kaufman in zwei Minuten. Stellt sich die Sinnfrage. Wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Kaufmans Drehbücher geben keine Antworten auf diese – im Grunde seines Herzens – ernst gemeinte Frage, sondern Ausflüchte und immer neue Abwege, die so durchgeknallt wie alle tun nur im Kontext Hollywood sind. An dem aber arbeitet sich Kaufman ab, als gelte es sein Leben. So wenig kann er vom Feindbild absehen – dem klar strukturierten Drehbuch nach Schema-F-Erfolgsrezepten -, dass er es hineinschreiben muss ins eigene, dass er sich, hier, gar, aber nicht im Ernst, am Thriller versucht mit, das hatten wir schon, Waffen, Drogen, Krokodilen. Aus diesem Kuddelmuddel, das als Dekonstruktion des Hollywoodfilms zu bezeichnen nicht einmal verkehrt ist (auch dazu natürlich ein Scherz im Film), führt kein Weg mehr hinaus, auch nicht für den Kritiker. Irgendwie steht der auch schon mit drin, im Buch. Wenn er dann sagt: das überzeugt mich nicht, es bleibt zu viel Beliebigkeit, mancher Scherz ist doch vorhersehbar, ist Charlie Kaufman allhier. Sitzt da bei der Pressekonferenz, ein schüchterner Kerl mit Bart und ohne Haarausfall (ganz im Unterschied zum Film), und macht den Eindruck, als sei ihm all das, die Ironie, die Evolution, die Adaption, die Selbstreflexivität und die Sehnsucht nach der einen großen Leidenschaft, bitter Ernst. Der Kritiker ist auch nur Mensch: Vor „Adaptation“ streckt er die Waffen. ... Link
Io non ho paura (Gabriele Salvatores; Italien 2002)
Reuthebuch
11:32h
Gabriele Salvatores hat ein untruegliches Gespuer fuer die Verdichtung auf einen Moment und ist mit einer ausgezeichneten Beobachtungsgabe gesegnet. Darueber gibt es keinen Zweifel, wenn man „Io non ho Paura“ gesehen hat. Dennoch will der Film ihm nicht zu einem Ganzen geraten, kommt der dramaturgische Motor immer wieder ins Stottern. Das mag sicher auch an der Entscheidung liegen, die Geschichte konsequent aus der Sicht des 10-jaehrigen Michele zu erzaehlen. Die Wahrnehmung des Kindes bedingt es, die Thrillerhandlung, wenn man sie denn so nennen will, ausschnitthaft immer wieder ins Bild zu ruecken. Eine Handlung, die an sich schon, egal fuer welche Perspektive man sich entschieden haette, duenn erscheint. Die Staerke des Films liegt dann auch eher in seinen Details, die Salvatores ausgesprochen oekonomisch einsetzt um im Mikrokosmos seiner Szenen kleine Geschichten zu erzaehlen. Wenn der skrupellose Sergio mit Michele im gleichen Zimmer schlaeft etwa, schnappt er sich wie selbstverstaendlich eine Muecke aus der Luft und zerquetscht sie achtlos mit einer Handbewegung am Bettlaken. Oder das immer wiederkehrende Motiv der Kornfelder, durch das die Kinder in der ersten Einstellung des Films sorglos tollen. Spaeter wird Michele aleine mit seinem Rad ueber die Felder blicken und am Horizont drei Maedrescher erblicken, die, wie in einem Spaghettiwestern darauf warten ihre Flinten zu ziehen. High Noon in Apulien. Haefig haben diese Momente, und das ist vielleicht das schoenste an diesem Film, eine Leichtigkeit, trotz der sich zuspitzenden Handlung, die die Figuren aus dem Kontext herausloest; die eine Atmosphaere schafft, aus der sich traumhaft die Erinnerung an Kindheit speist, an diese magische Zeit im Leben, in der alles Fremde, und sei es nur ein italienischer Kleinwagen, der sich auf einem staubigen Feldweg durch die Kornfelder quaelt, ein Versprechen auf das grosse Abenteuer war. ... Link
Hero (Zhang Yimou, China 2002)
knoerer
07:52h
Einen enttäuschenden Film nach dem anderen hat der einst so große chinesische Regisseur Zhang Yimou in den letzten Jahren gedreht. Zusehends hat sich die schneidende Schärfe, die seine Meisterwerke „Das rote Kornfeld“ oder "Rote Laterne" auszeichnete, verloren. Yimou begann, mit „Heimweg“ oder dem zuletzt gelaufenen „Happy Times“, läppische Geschichten zu erzählen, die sowohl den Bezug zu den chinesischen Realitäten, den noch „Die Geschichte der Qiu Ju“ besaß, als auch die Wucht seiner großformatigen früheren Werke vermissen ließen. Präzision und Radikalität wurden ersetzt durch politisches Kompromisslertum (egal, was man in „Happy Times“ so alles hineinzulesen bemüht war) und eine Altmännerpoesie, die die Schönheit nur noch um der Schönheit willen feierte. Auf sein neuestes Werk „Hero“ durfte man nun gespannt sein. Erstmals wagt sich der Kunstfilmer Zhang Yimou ans Martial-Arts-Kino, ermutigt, das sagt er selbst, durch den großen Erfolg von Ang Lees „Tiger and Dragon“. Ein wenig ungewöhnlich ist die genaue historische Situierung seiner Geschichte - zu den Problemen, die er sich damit eingehandelt hat, später. Angesiedelt ist „Hero“ in der Zeit der großen Kriege, die in die brutale Einigung des Reichs unter dem Herrscher von Qin mündeten, der dadurch zum ersten Kaiser von China wurde. Seine Figur ist legendenumwoben, schon Chen Kaiges „Der Kaiser und sein Attentäter“ aus dem Jahr 1998 erzählte von einer dieser Legenden. Atemberaubend klar ist zunächst einmal die Struktur des Films. Das Zusammentreffen des Schwertkämpfers mit dem schönen Namen „Namenlos“ mit dem König Qin gibt den Rahmen, in den hinein die Vorgeschichte dieser Begegnung erzählt wird. Namenlos hat die drei ärgsten Widersacher des Königs - auch sie tragen schöne Namen: Broken Sword, Flying Snow und Sky - besiegt, zum Beweis hat er ihre Schwerter mitgebracht und darf nun berichten, wie das zuging. Und zwar, als Erweis der Herrschergunst, in beispielloser Nähe zu dessen Thron: ganze zehn Schritte entfernt sitzen sie sich gegenüber, der Kaiser und der Held. So klar die Struktur, so verschieden, zeigt sich bald, die Versionen der Dinge, die zur Begegnung führten. In Rashomon-Manier bekommen wir Varianten geboten, eine erste, in der Namenlos mit mehr List als Kämpferkunst die Attentäter besiegte. Eine zweite, der Wahrheit näher, die der König vorschlägt. Und zuletzt eine dritte, die endgültige, die wahre, der in den letzten Bildern des Films noch ein Monument errichtet werden wird. Höhepunkte aller drei Geschichten sind, wie könnte es anders sein, die Kampfszenen - atemberaubend alle miteinander. Interessant schon, dass Zhang Yimou nicht in erster Linie auf Schnelligkeit setzt, im Schnitt etwa, sondern auf Verlangsamungen. Meist sind zwischen die Kämpfer und ihre Schwerter Medien geschaltet, Regen etwa, Pfeilhagel oder fallende Blätter, mit der Folge, dass der Raum und die Zeit noch einmal, im Kontakt mit diesen Medien, gedehnt, verschoben und zugleich materialisiert werden. Das Wasser, die Pfeile, die Blätter machen Bewegung sichtbar als Matrix, in die diese hineingezeichnet wird. Weit konventioneller als dieser Umgang mit Raum und Zeit in der Inszenierung der Kämpfe ist die ästhetische Stilisierung der drei Episoden. Sie werden in jeweils unterschiedliche Farben getaucht, blau, weiß, rot, grün zuletzt, wallende Gewänder und Stoffbahnen, genau geplante Lichtwechsel, all das wirkt ein wenig wie von Robert Wilsons Theater abgeguckt und schrammt, im Verbund mit den großformatigen Landschaften, die sich Yimou aus ganz China zusammengeklaut hat, gelegentlich nur knapp am Kitsch vorbei. Von erhabener Größe ist jedoch der Höhepunkt des Films, ein Kampf auf der Oberfläche eines Bergsees, ein wunderbar choreografiertes Konzert aus Wasser und Bewegung, Schwert und Landschaft, Ton und Bild. Leider aber ist Yimou die Kunst der Martial Arts nicht genug. "Hero" bietet eine spirituelle Botschaft als Dreingabe - und die läuft, um es kurz zu machen, darauf hinaus, dass der wahre Held den Tyrannen verschont, sein Leben opfert, wenn es um die große nationale Sache geht. Gewiss ist die Rede von Frieden und Gewaltlosigkeit - dies aber bleibt angesichts der historischen Rolle des überaus brutalen Kaisers Quin eine mehr als zweischneidige Angelegenheit. Zhang Yimou beteuert in der Pressekonferenz mehrfach, dass er nicht die Absicht gehabt habe, einen politischen Film zu drehen. So naiv aber kann er nicht wirklich sein - und es ist alles andere als verwunderlich, dass die alten Herren des chinesischen Politbüros auf dieses Werk weitaus beglückter reagiert haben als die Bürgerrechtler. Besonderes Unbehagen bereiten im übrigen die letzten Bilder des Films, entpolitisiert zum Monument opferbereiter Liebe auf der einen Seite. Und die Aufmärsche der herrscherlichen Garde auf den weiten Plätzen des Palasts wecken erst recht ungute Gefühle - die Art, in der Yimou hier die Masse als Ornament inszeniert, ist von Leni Riefenstahl so weit nicht mehr entfernt. ... Link Freitag, 7. Februar 2003
Alan Parker: The Life of David Gale (USA 2003)
knoerer
19:50h
Die stärkste Einstellung von Alan Parkers Film „The Life of David Gale“ ist die erste: im Vordergrund ein Feld vor weiter Landschaft, im hinteren Drittel des Bildes eine Straße, ein Auto mit qualmendem Motor. Daraus steigt eine Frau und rennt so schnell sie kann. Man weiß nicht, wohin, man weiß nicht, warum. Aber man wird es erfahren, denn auf Schließungen offener Klammern, auf Erklärungen aller Art ist der Film aus, über alle Umwege hinweg, die er nimmt, die er sucht und die er in Richtung abstruser Auflösungen am Ende wieder verlässt. Am Anfang steht ein journalistischer Auftrag. David Gale (Kevin Spacey), einst renommierter Philosophieprofessor in Austin, Texas und zugleich einer der prominentesten Gegner der Todesstrafe, sitzt nun selbst als verurteilter Mörder in der Todeszelle. Er bittet Bitsey Bloom (Kate Winslett) – die Frau, die wir rennen sahen – zum exklusiven Gespräch, drei Tage lang, am vierten folgt das Schlusskapitel: seine Hinrichtung. Keineswegs will er dem Tod durch Injektion entgehen, nur die Wahrheit, fleht er, soll ans Licht, seines Sohnes, seiner Familie wegen, die ihn nicht länger für einen Mörder halten soll. Die Gespräche zwischen Gale und Bloom bebildert Parker als Rückblenden, die sich in der Annäherung an die Gegenwart zu einer wahrhaft unglaublichen Geschichte verdichten, in der am Ende nichts ist, was es schien. Allerdings, so viel zur Raffinesse des Drehbuchs: das ahnt man schnell – und auch die letzte Pointe kennt man lange, bevor sie dann ins Bild findet. Ohne zu viel zu verraten, ist so viel zu sagen: „The Life of David Gale“ nähert sich dem Thema Todesstrafe auf denkwürdig absurde Weise. In der Auflösung erweist sich der Film nicht nur als himmelschreiend unglaubwürdig in seinen Motiv-Konstruktionen, sondern schlicht als reaktionär. Gewiss: Gezeigt wird die Möglichkeit eines Justizirrtums, hingerichtet werden soll ein Unschuldiger. Die Umstände aber, unter denen das geschieht, entwerten die politische Aussage des Films vollständig. Das Argument des möglichen Irrtums erweist sich als plumpe Fälschung, den Gegnern der Todesstrafe spielt das Drehbuch gezinkte Karten in die Hand. Hinter dieser kaum fassbaren Torheit verschwinden beinahe all die anderen Untugenden, an denen der Film nicht arm ist. So wird etwa der komplexe Gegenstand im letzten Drittel ohne jeden vernünftigen Rest in eine mechanisch dahinklappernde Thriller-Maschine gesteckt, mit allem Drum und Dran wie tickenden Uhren, bebenden Lippen und brüllender Streicher-Musik. Und während es Kevin Spacey in den „Schiffsmeldungen“ vom letzten Jahr immerhin noch gelungen ist, inmitten eines unsäglichen Films seine schauspielerische Würde zu bewahren, muss man nun mit Bedauern feststellen, dass er das so überdeutliche wie manipulative Spiel, das Alan Parker hier treibt, grimassierend mitspielt . Seine viel gepriesene Fähigkeit zur darstellerischen Reduktion muss ihm irgendwo tief in Texas abhanden gekommen sein. ... Link
Das Leben des David Gale (Alan Parker; USA 2002; 132 min)
Reuthebuch
15:49h
Kate rennt ! Alan Parker, bereits in den siebziger Jahren mit Filmen wie „Midnight Express“ oder „Birdy“ zu Weltruhm gekommen, will im diesjaerigen Berlinale Wettbewerbsbeitrag „Das Leben des David Gale“ zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, einerseits konventioneller Thriller, andererseits engagiertes Politkino sein. Ums deutlich zu sagen: das Unterfangen misslingt an beiden Fronten gruendlich. Ort der Handlung ist Texas, Huntsville, unweit von Austin, dem libertaeren Zentrum des riesenhaften Staates, in dem vieles amerikanischer ist als anderswo in Amerika. Auch was die Vollstreckung der Todesstrafe angeht, nimmt Texas eine Sonderstellung ein. Man ist hier eben stolz auf seine Traditionen. Die eigentliche Ueberraschung besteht darin, dass man bei einem Routinier wie Parker nicht vermuten wuerde, dass gerade handwerkliche, sprich dramaturgische Schwaechen derart deutlich auftreten wuerden. Klar zeigt man da mit dem Finger schnell auf den Drehbuchautor, doch man wird das Gefuehl nicht so recht los, dass man etliche Szenen erst vor Ort umgearbeitet hat. Zu billig sind die Mittel, mit denen dramaturgische Probleme, oft ausschliesslich ueber die Dialogebene geloest werden. Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf die Haltung des Films, die Parker offensichtlich (im Presseheft beschaeftigt er sich untypischerweise fast ausschliesslich mit dieser inhaltlich-thematischen Ebene) so ueberaus wichtig ist. Das schürt natürlich auch Erwartungen und letztlich muss Parker sich an seinen eigenen Ansprüchen messen lassen. Exemplarisch sei dabei der dramatische Hoehepunkt herausgegriffen, in der Kate Winslet das Rennen gegen die Zeit verliert, David Gale exekutiert wird und die Gegner und Befuerworter der Todesstrafe, wie Fangruppierungen von Fussballvereinen vor dem Staatsgefaengnis aufmarschieren. Mittendrin natuerlich die unvermeidliche Reporterschar. Mit schnellen Schnitten werden der Vollstreckungsapparat, die Medienmaschine und die sich hetzende Kate gegeneinander ausgespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was bleibt, sind Allgemeinplaetze und die Erkenntnis, dass nicht immer der Zweck die Mittel heiligt. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8770 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

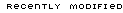
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||