
 |
... Vorige Seite
Dienstag, 11. April 2006
es zwitschern die ratten
knoerer
19:29h
"Citypaper", das alt-weekly von Baltimore, bietet jede Woche den "Murder Ink", die kurz kommentierte Liste der jeweils gewaltsam zu Tode Gekommenen. Natürlich sind sie fast alle schwarz und unter dreißig. Ein beliebiger Eintrag: Thursday, March 30, 3 p.m. Victor Richards, a 23-year-old African-American man, was standing in the 1300 block of Montford Avenue in the Broadway East neighborhood when a man came up to him and shot him several times. He died an hour later at Johns Hopkins hospital. This is the fourth murder in Broadway East this year. Vier Morde listet der Murder Mix für die letzte Woche, oft sind es mehr, Baltimore hat eine der höchsten Kriminalitätsraten der USA. Zwar gibt es die Ghettos, auf die sich das konzentriert, aber eine gewisse Grundgefährlichkeit diffundiert in die meisten Gegenden der Stadt. Ilchester Street, wo ich untergekommen bin, macht einen halbwegs sicheren Eindruck, aber nur zwei Straßen weiter sieht man neben den üblichen Porches hier und den schmutzigen und rattenverseuchten Back Alleys mit Brettern vernagelte Türen und Fenster und nur wenige Menschen auf der Straße, darunter so gut wie keine Weißen mehr. Nach dem skandinavisch-freundlichen Minneapolis ist der Kontrast noch stärker spürbar: überall Schmutz und Müll, nur dass gerade der Frühling ausgebrochen ist und die Bäume beginnen zu grünen, manche Sträucher zu blühen. Vorgestern hat mich A., nachdem er mich am Samstag Abend vom Flughafen abholte, wo der schon am Mittag als verspätet gemeldete Flug aus Atlanta dann doch nicht verspätet war (vgl. dazu textmarkerfiles 4/8/2006), durch Baltimore geführt. Von hier – ich sage mal: - oben, 28. Straße, in der Nähe des Johns-Hopkins-Campus und durchs – ich sage mal: - Künstlerviertel Hampden, wo wir für wenig Geld eine kleine Bar fürs Wohnzimmer mit drei Stühlen hätten kaufen können, nach unten, wo die Stadt ihr Gesicht und ihren Geruch und das Gefühl, das man hat für den Ort, an dem man ist, immerzu verändert. Es endet alles am Inner Harbor, der eine disneyfizierte Wohlfühlgegend ist, für die Massen an Touristen jedenfalls, die man hier findet, am Wasser, am Segelschiff, das mit stolzgeschwellter Takelage nichts tut, an den rausgeputzten Speicherfassaden. Wir setzen uns dann ins Café Bonaparte, dessen – ich sage mal: - Chefin einen beachtlichen französischen Akzent kultiviert vor der Schlacht von Wagram, die als Stich an der Wand hängt, neben allerlei anderem Napoleonischen. Wir sitzen am Tisch und sprechen über R.C. und B.V. und A.H. und wenige Minuten später kommen alle drei durch die Tür, was insofern erstaunlich ist, als A.H. mein Doktorvater aus Frankfurt (Oder) ist und ich ihn jetzt hier nicht unbedingt erwartet hätte. (Es gibt aber eine Erklärung, die die Unwahrscheinlichkeit des Ganzen beträchtlich mindert.) Erstmals bin ich etwas müde und habe keine große Lust mehr auf die eigenhändige Exploration der Stadt; es hat auch damit zu tun, dass ich wohl den Herbst hier verbringen werde, da lässt sich vieles gut aufschieben. Es hat auch damit zu tun, dass die Universität und das an sie anschließende Charlesville den Eindruck machen, vom Rest der Stadt gut separierbar zu sein. Ich gehe zum Campus, trinke einen Cappuccino, sehe den unzähligen Führungen zu, bei denen Studenten höherer Semester rückwärts gehend Gruppen zukünftiger Undergrads die Vorzüge der Universität erläutern. (Mit den Medizinern, für die die Uni berühmt ist, hat man hier allerdings wenig zu tun; die haben einen eigenen Campus woanders, in einer sehr bedenklichen Gegend der Stadt, sagt A., der mir auch von zwei Morden an Undergraduates berichtet. Seither steckt man mehr Geld in die Sicherheit, das Security-Personal ist in der Tat präsent und nicht nur am German department bekommt man die Umverteilungsmaßnahmen im Budget zu spüren.) Dann gehe ich wieder zurück, den selben Weg, oder durch eine Parallelstraße, genieße die Sonne und die Wärme, die bleiben sollen, sagt der Wetterbericht, lese ein bisschen und surfe ein bisschen durchs Netz und plane den Rest der Reise. Bei tripadvisor.com habe ich Erstaunliches über Hostels in New York gelesen (hier die Seite mit dem Link zu candid traveler fotos von bedbug-Spätfolgen vom Whitehouse hostel, in dem ich zunächst für drei Nächte reserviert hatte; not for the faint of heart) und dann in den zweien reserviert, die am besten klangen. Gestern aber eine Mail von Z., der mir eine Unterkunft bei Freunden in Park Slope, Brooklyn vermitteln kann. Aber diese Mail bringt mich auf die Idee, einmal nachzusehen, wo eigentlich Providence liegt, der Ort, an dem er unterrichtet. Stellt sich heraus, der Zug oder Bus fährt da hin von New York und braucht kaum mehr als drei Stunden. So beschließe ich, diesen letzten Schlenker noch zu machen vor der Rückkehr nach Austin in knapp zwei Wochen, von A. bis Z. die Menschen hier zu besuchen, die ich aus Konstanz kenne und Frankfurt (Oder) – oder es stellt sich heraus, wie im Fall von J. in Chicago, dass eine Freundin aus Konstanz den Kontakt herstellt und er war während des Studiums in Frankfurt (Oder), wo wir uns, im Jahr 1996, hätten über den Weg laufen können zwischen Oderturm und Kellenspring; oder wo wir uns, genauer gesagt, ganz gewiss über den Weg gelaufen sind, ohne zu wissen, dass wir uns erst zehn Jahre später in Hyde Park, Chicago tatsächlich begegnen würden. Sie fragen mich nach der Maus (vgl. textmarkerfiles)? Heute Nacht, so viel kann ich sagen, hat es verdächtig geraschelt. Zu Kunststücken kam es nicht. Die Erdnussbutter wurde nicht angerührt. Das andere Geräusch, das man nachts um zwei hört, sind nicht, wie ich im Halbschlaf erst dachte, die allzu früh erwachten Vögel, es zwitschern die Ratten da draußen, lange bevor der erste Streif des Morgens am Himmel zu sehen ist. ... Link Samstag, 8. April 2006
eher kubistisch als post-explosiv
knoerer
21:49h
In anderer, gar fremder Leute laufender Leben zu platzen, ist eine großartige Erfahrung, gerade wenn man nur kurz da ist. Alles geht weiter und freie Minuten gelten dem Gast, ohne dass der Alltag aufgegeben würde. In Chicago habe ich im Wohnzimmer meiner Gastgeber geschlafen, in dem auch einer der Computer steht. Die Couch wird ausgeklappt und ich bin da und klappe sie zurück am Tag und verschwinde am Tag und kehre zurück am Abend und werde als Selbstverständlichkeit behandelt. Sehr schön ist es, dass die beiden in meiner Gegenwart auch miteinander sprechen, ohne dabei mit mir zu reden; es gibt eine Höflichkeit des Selbstverständlichen daran, die mich sehr rührt. Ich bin Gast, ohne groß als Gast behandelt zu werden. Sie kennen mich gar nicht, aber vertrauen mir ganz. Spät in der Nacht, hier, in Minneapolis, sehe ich mit R. und V. noch die Aufzeichnung vom ersten Viertel der Detroit Pistons gegen Miami Heat und werde nebenbei in die Feinheiten der amerikanischen Basketball-Szenerie eingewiesen. Ich empfinde jetzt, glaube ich, so weit die richtigen Sympathien. Die Pistons sind eine Mannschaft ohne großmäulige Stars, die nach Körben gieren, sie spielen als Team und werden hoffentlich Meister. (Derzeit sieht es gut aus.) Zuvor habe ich mir mit R. die Keynote zu einer Graduiertenkonferenz angehört von einer Professorin, die erzählt, dass die Rechte an ihrer Uni sie lächerlich machen will, weil sie Seminare über das Menschliche und das Hündische anbietet. "Facing Shame" heißt der Vortrag und es geht auch gegen Bush; wir sollten lernen, mit unserer Scham umzugehen und wir lernen das in einem Ausschnitt aus dem Faßbinder-Film "In einem Jahr mit 13 Monden". Vor dem Vortrag treffen wir A., den ich nicht kenne, aber von J., der mein Gastgeber in Chicago war, grüßen soll. Ich grüße und er freut sich. Die Graduiertenkonferenz ist eine Graduiertenkonferenz, alle haben allen viel zu beweisen. (Nicht dass gewöhnliche Konferenzen sehr viel anders funktionieren. Habe gerade auch einen großartigen Text von R. gelesen, über die Dubrovnik-Kolloquien unter Leitung von Hans-Ulrich Gumbrecht, einst in den Achtzigern.) Das Kunstmuseum in Minneapolis ist das übliche Best-of und die Abteilung, die das Post-Impressionistische zeigt, ist gerade geschlossen. Ich sehe noch einen Caillebotte (ein Akt auf der Couch mit einem Modell, mit dem er dann ein Verhältnis hatte. Oder er hat sie geheiratet, das weiß ich gerade nicht mehr so genau.) Als erste suche ich jetzt immer die China-Abteilung auf, wegen der literati-Landschaften der späten Ming- und frühen Qing-Periode. Davon gibt es aber leider nicht sehr viel hier. Vom Museum geht es nach Downtown, die Nicolett Avenue hinunter, die Eat Street, tatsächlich ein Restaurant neben dem anderen, noch vor ein paar Jahren war das ganz anders, wird mir V. sagen. Hinein in die Innenstadt und die Avenue wird zu einer Art Fußgängerzone. Es ist beinahe wie Europa und sogar wärmer als prophezeit, denn in Minneapolis ist, von Kanada her, eigentlich sehr lange Winter und darum haben sie in der ganzen Innenstadt diese Skyways gebaut, eine zweite Stadt, nach innen gestülpt. Über die Straßen führen verglaste Wege von Hochhaus zu Hochhaus und darinnen dann weiter, um Ecken und Ecken; offen liegen die Banken da, die in den Häusern ihre Geschäfte abwickeln, überall Fast Food und auch Edleres und Geschäfte aller Art, sogar der Zugang zum Barnes & Noble über diese Innenwelt. Es ist belebt und keineswegs nur sind hier Geschäftsleute unterwegs. Einmal im Jahr gibt es, wird V. später erzählen, ein Radrennen durch die Skywalks. Ich stelle mir vor, ich stehe draußen und blicke hinein ins Glasgehege, das über die Straße führt und es flitzen die Radler auf ihren Rennrädern durch. Es wird dunkler und dann legt der Regen los, ganz heftig, R. zeigt mir noch dies und das, den Uni-Campus vor allem, der den Mississippi quert und der Fußgängerweg hat in der Mitte gleichfalls eine Art Skywalk, der an den Langen Jammer in Friedrichshain erinnert, den es aber nicht mehr gibt. Nur blickt man nicht auf das zur Stadtbrache gewordene ehemalige Schlachthofgelände, sondern auf den großen Fluss, der ziemlich tief unten mächtig dahinfließt, ein paar Hundert Meter hinter einem imposanten Wasserfall im einstigen Mühlenviertel, das gerade umgebaut wird. In dunklem Blau steht dort – im Mühlenvierte – jetzt ein neuer Theaterbau von Jean Nouvel, wie ein Sprungbrett ragt ein Steg hinaus, auf den Mississippi zu und trotzt, blau und beherzt, der Schwerkraft. Nach der Führung über den Campus gehen wir zurück über den Skywalk über den Fluss und in den von Gehry entworfenen, eher kubistisch als post-explosiv anmutenden Bau, in dem gleich die Keynote zur Graduiertenkonferenz beginnt. Wie Sie merken, ist die Chronologie jetzt durcheinander. Das Walker Arts Center ist das MoMA von Minneapolis, mit ambitioniertem Programm und einem erst im letzten Jahr eingeweihten Anbau von Herzog-De Meuron, der in kleine Rechtecke einer Außenhaut gekleidet ist, die aussieht wie silberner, leicht gewellter Stoff. Es gibt Scheußlichkeiten von Kiki Smith, pompejanisch gekrümmte Leiber an Wänden und auf Fußböden, Körper-Kunst der unerquicklichen Art. Abends läuft im Kino des Walker gerade die "Selling Democracy"-Reihe, die nach der Premiere bei der Berlinale jetzt auf US-Tour ist und in Minneapolis Station macht. Es sind Propaganda-Filme, die von Geldern des Marshall-Plans finanziert werden, aber von Regisseuren der einzelnen Länder produziert wurden. Die Serie mit den offen antikommunistischen Sachen läuft heute Abend erst, aber da sitze ich schon im Flugzeug nach Baltimore, und das ist schade, denn R. wird die Filme hinterher kommentieren. Dafür haben wir eine Dose Milchpulver kennengelernt, die als Ich-Erzähler berichtet, wie sie wurde, was sie ist. Das ist sehr lustig, denn sie informiert uns auch über ihr Schmerzempfinden (Pasteurisierung) und ihre Lust (beim Runterkühlen). In einem anderen Film, in dem es um ganz anderes geht, wird eine Maus verschüttet und wühlt sich wieder ans Licht. Das gibt Szenenapplaus im sehr zahlreichen Publikum, in dem sich viele ältere Menschen finden. Schwer erträglich ist die Kuratorin, Frau Schulberg, deren Vater damals für das Marshall-Plan-Filmprogramm mitverantwortlich war. Auch ihr Bezug zum Thema ist offenkundig, denn die sehr lange Kurzbiografie im Programmfaltblatt teilt mit: "She was conceived during the Berlin Blockade." (Die genaueren Umstände bleiben uns erspart.) ... Link Mittwoch, 5. April 2006
so amtrak
knoerer
15:27h
Downtown Chicago hält Abstand zum See, der die Stadt im Osten begrenzt, oder auch öffnet, auf einen fernen, weiten, offenen Horizont hin. In dieser Abstandszone liegen Parks, die in der Kühle des frühen April wenig besucht sind, vor allem aber auch große, am Zentrum vorbeiführende Straßen, die überwinden muss, wer in einen der Parks gelangen will. Das neueste Projekt ist der Millennium Park, mit dem sich der lange schon regierende Bürgermeister Daley ein Denkmal gesetzt hat. Es ist, wie bei Denkmälern dieser Art üblich, außerordentlich teuer; immerhin hat die Anlage ihren Reiz, mit einem sich in kontrollierter Explosion auffaltenden Bau von Gehry zum einen, der sich – buchstäblich – in einem Kunstwerk von Anish Kapoor gespiegelt findet. Kapoors Cloud Gate, soeben erst fertiggestellt, ist eine rundum alles, was sich in seiner Nähe befindet, spiegelnde bohnenförmige Skulptur, die nur auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit einem der hässlichen Gebilde von Jeff Koons hat, die so manchen hübschen Ort so mancher ehrgeizigen Stadt verunzieren. Auf den zweiten Blick ist das Cloud Gate das perfekte Gegenstück zum Gehry-Bau, ganz konzentriertes In-Sich-Sein und In-Sich-Aufnehmen der Außenwelt. Es spiegeln sich die Wolkenkratzer von Downtown und, ebenso groß und ebenso verformt, die Menschen, die um die Skulptur herumstehen und darauf zu gehen und staunen. Am linken Rand von Gustave Caillebottes "Paris Street; Rainy Day" gibt es eine Auflösungserscheinung. Zum Rahmen hin verschwimmt alles Figurale in einen Farbnebel und in diesem Nebel verschwindet eine Kutsche, deren Hinterteil neben einem der in diesem Bild lustwandelnden Pariser des 19. Jahrhunderts zu sehen ist und deren Vorderteil zur Linken des Mannes eigentlich wieder erscheinen müsste. Der monumentale Caillebotte überstrahlt kühl all die süßlichen Renoirs im selben Raum. (Auf einem Bild ist, mit langem, rotem Haar, der junge Jean Renoir zu sehen. Er sieht aus wie ein Mädchen.) Nach einem Besuch im "Museum of Contemporary Photography", wo ich erstmals in voller Länge das wunderbare Video "Der Lauf der Dinge" von Fischli/Weiss gesehen habe, habe ich kurz nach elf das Art Institute of Chicago betreten, um es erst zur Schließung um 16 Uhr 30 wieder zu verlassen. Es war Free Tuesday, Eintritt umsonst, von Ford gesponsort, und es wimmelte, aber in keineswegs unangenehmer Weise, von Schulklassen, denen vor ägyptischer Kunst und amerikanischem Design, französischen Impressionisten und buddhistischen Statuen, vor abstrakten Expressionisten und allerlei Kubisten die Augen übergehen sollen. Das Museum ist eine Wunderkammer mit wiederum enzyklopädischer Absicht. Hoppers "Nighthawks" sind hier, was ich nicht wusste, eine Menge van Goghs, aber auch das Bildnis des Dorian Gray von Ivan Albrecht aus dem gleichnamigen Film. Es kam mir bekannt vor, ich wusste nur erst nicht woher. Daneben hängt, auch von Albrecht, die finsterste Tür, die man sich vorstellen kann. Gleich drei tamilische Filme von Mani Ratnam aus den achtziger Jahren mit englischen Untertiteln habe ich in einem indischen CD- und DVD-Laden auf der Devon Avenue gefunden, die im äußeren Norden der Stadt liegt und an nichts so sehr erinnert wie an Little India und die daran angrenzenden Straßen in Queens, New York. Man ist, betritt man diese Zone, nicht mehr in den USA, sondern in einem unbestimmbaren Anderswo, das dezidierte Anleihen am Indischen nimmt. Die Devon Avenue ist sehr lang und auf mehr als einem Kilometer reihen sichh indische Restaurants, Lebensmittelmärkte, Sari-Boutiquen und DVD-Shops mit exzellenter Auswahl. Von dem auf meine Nachfragen hin zusehends freundlicher werdenden älteren Herren werden mir auch zwei Telugu-Filme empfohlen; selten habe ich die Werke in dieser Sprache bisher mit englisch untertitelt gefunden. Irgendwann, fast unmerklich erst, verwandelt sich Indien in Arabien erst, daran schließt sich ein jüdischer Teil an. In einem Schaufenster hängt ein Plakat, auf dem der Ladenbesitzer sein koscheres Sushi preist. Sehr viele Straßen in Chicago haben nicht nur einen Namen, sondern ehrenhalber, auf einem braunen statt der üblichen grünen Schilder, angezeigt, einen zweiten. Man erspart sich so offenbar Umbenennungen (ich sage nur Dutschke-Straße in Berlin) und ehrt doch verdiente Menschen. Hier auf der Devon Avenue stoßen an einer Kreuzung die "Honorary Golda Meir Street" und die "Honorary Mother Theresa Street" in freundlicher Koexistenz aufeinander. Die University of Chicago, in deren unmittelbarer Nähe im südlichen Bezirk Hyde Park ich hier bei überaus reizenden und gastfreundlichen Menschen untergekommen bin, hat das ambitionierteste Uni-Kinoprogramm, das mir je begegnet ist. An jedem Abend läuft ein Film aus einer der sieben Reihen, aus denen das Programm besteht. Ich sehen Martin Ritts "Hombre" von 1967 (Reihe "Conscious Western"), die Verfilmung eines Romans von Elmore Leonard. In Austin noch habe ich, um das endlich mal zu tun, einen Western von Leonard gelesen, "Valdez is Coming", der mir sehr gefiel. Sehr elegant durchgezogene Geschichte um eine Art Wiedergutmachung (und eine Art Rache), die einem die Sympathie mit dem Helden so wenig aufnötigt wie es nun auch "Hombre" tut, der Film, in dem Paul Newman dieser Held ist, der kaum etwas sagt und kaum eine Miene verzieht, der dennoch in einer Situation, in der er es nicht müsste, das Richtige tut und es kostet ihn das Leben. Lakonische Wort- und Blickwechsel, keinerlei Heroismus, auch Martin Ritt macht nichts verkehrt. Ausgesprochenes Pech habe ich mit der Luc-Moullet-Retrospektive, die gerade anläuft. Der erste von acht Filmen wird am Abend vor meiner Ankunft und am Abend nach meiner Abfahrt gezeigt. Dazwischen ist nichts, auch die Einführung in Moullets Werk durch Jonathan Rosenbaum hätte ich mir gerne angehört. (Es findet sich aber ein Text von Rosenbaum im aktuellen Chicago Reader, der das umsonsst ausliegende alternative weekly der Stadt ist und, anders als die mir bisher begegneten Stadtmagazine, ziemlich auf dem selben Niveau wie, aber umfangreicher als, die New Yorker Village Voice.) Das Wetter in der Windy City war erst sehr abweisend, dann wurde es freundlich. Mit J. & J. war ich gestern Abend auf einem Konzert von "Devil in the Woodpile", die es mit ihrem sehr relaxten, virtuos handgemachten Retro-Südstaaten-Jazz bis in meinen Time-Out-Stadtführer geschafft haben. In der Nacht sieht der Sears-Tower, das höchste Gebäude der Stadt, aber nicht mehr der Welt, beinahe aus wie ein riesiger Kirchturm. Und demnächst wird in weiß, sich verwindend, nach einem Entwurf von Calatrava, einer der – dem Modell nach zu urteilen – schönsten Wolkenkratzer der Welt, den Sears Tower übertreffen. Von hier nach Minneapolis sind es acht Stunden mit dem Zug, wenn Amtrak hält, was es verspricht. Denn von St. Louis nach Chicago landete ich verblüfft in einem ersatzweise fahrenden, aber keineswegs vorher angekündigten Bus, der dann prompt eine Stunde zu früh ankam. "This is so Amtrak", sagte J. ... Link Montag, 3. April 2006
golfball
knoerer
21:03h
Nach meiner Hotel-Absteige in Kansas City ist das Radisson Hotel in downtown St. Louis eine andere Welt. Wenn ich schräg aus dem Fenster blicke, sehe ich den riesigen metallenen Gateway Arch am Ufer des Mississippi, das 630 Fuß hohe Wahrzeichen der Stadt, das höchste von Menschenhand erbaute Monument der USA. Sagen die Reiseführer, von denen es nicht viele gibt. Ansonsten nämlich ist St. Louis an Attraktionen, die Touristen interessieren, nicht sehr reich. Downtown gibt es Stadien und Convention Center, monumentale Bauten, um die herum sich Todesstille ausbreitet, jedenfalls dann, wenn, wie jetzt, keine Spiele stattfinden. Soeben fertiggestellt wurde das neue Busch-Stadion, in dem die St. Louis Cardinals ihre Spiele austragen. (Aber war das nun Baseball oder Football?) Es wird einem hier exemplarisch klar, warum Innenstadt für downtown als Übersetzung in aller Regel ein Kategorienfehler ist. Der Zusammenhang der amerikanischen Großstadt stellt sich über das Auto her, nicht über den Fußgänger; über geplant oder zufällig entstehende kleine Zentren, zwischen denen nicht viel mehr ist als nichts. Sprawl ist das, was das Innere dieser Städte ausmacht, die immer schon mit Nicht-Stadt, wenn nicht gar mit der Sonderform von Nicht-Stadt namens Suburb durchsetzt sind. Es gehören zu dieser Organisationsform Inseln, die einem ohne jeden Kontext erscheinen, aus dem Zusammenhang der Straßen gefallen, die sie umgeben. Eine solche Insel ist die St. Louis University, auf die ich stoße, weil das Museum of Contemporary Art gerade umbaut und deshalb geschlossen ist. Eigentlich will ich nur zur nächsten Metrolink-Station (das ist die S-Bahn, die dem losen Zusammenhalt der Stadt auch keine wirkliche Form gibt, weil sie viele zentrale Punkte auslässt). Auf dem Weg dahin stoße ich, inmitten ganz unscheinbarer Straßen ohne Geschäfte, ohne Leben, ohne Menschen, auf das Fox Theatre, glamourös im alten Stil; noch diese Woche wird dort "Bombay Dreams" Premiere haben, das Bollywood-Musical von A.R. Rahman und Andrew Lloyd Webber, das in London mit großem Erfolg lief, am Broadway nicht so sehr. Nun tourt es in einer kleiner dimensionierten Version durch die Staaten und macht auch eine Weile Halt in St. Louis. Der Held übrigens wird von einem Inder zweiter Generation aus St. Louis gespielt. Unweit des Theaters dann ein monströser Bau, der sich beinahe fensterlos viel Platz nimmt, in die Breite und in die Höhe, ein finsteres Wesen ohne jede Rücksicht auf seine Umwelt: Es ist der Masonic Temple. An eine Besichtigung ist so wenig zu denken wie an die Eroberung dieses Gebäudes, dessen Inneres, denkt man sich, aus Schwärze und Geheimnis und unendlich viel Raum für die Metaphysik des Architektonischen besteht. Quer über die Straße liegt dann aber eine verzauberte Insel ganz anderer Art. Sehr grün, gekämmter Rasen, sprudelnde Brunnen und pittoreske kleine Statuetten und Denkmälchen aller Art. Die Häuser wollen hübsch sein und tun so, als seien sie alt. (Das ist in den USA immer das am leichtesten zu durchschauende Täuschungsmanöver.) Junge Menschen in kleinen Gruppen liegen in der Sonne im Gras und schlendern durch die mit großer Sorgfalt angelegten Wege. Dies ist, an allen Seiten von Torbögen begrenzt, die St. Louis University, ganz und gar eine Welt für sich. Sie hat mit allem, was sie umgibt, nicht das mindeste zu tun. Man spürt das, tritt man nur einen Schritt hinaus, auf die Grand Street, wo sofort wieder die großflächigen Parkplatzbrachen auf einen warten, die die Betretbarkeit eines Ortes für den Automenschen signalisieren. Es ist in diesen Städten – ganz anders als in New York – einfach unendlich viel Platz, weil es so etwas wie eine Strecke, die einem lang werden kann, kaum gibt. Es ist kein Problem, mit dem Auto eine halbe Stunde zum Einkaufen zu fahren. Das Art Museum von St. Louis liegt in einer Gegenwelt anderer Art, dem Forest Park. Er nimmt einen Anfang, aber kein Ende. Er liegt, hätte es Sinn, so etwas zu sagen, mitten in der Stadt. Es ist Samstag und es ist die Hölle los. Hier sind Menschen, sehr, sehr viele Menschen. Sie joggen und ich muss aufpassen, dass ich nicht umgerannt werde. Und sie spielen Golf auf einem öffentlichen Golfplatz, direkt neben den Wegen für die Fußgänger, direkt neben den parkenden Autos. Die kleinen Golfwägelchen kurven über das riesige Grün, Menschen üben Abschläge und befreien sich aus Sandbunkern, putten und visieren und es scheint ein Wunder, denke ich mir, dass hier nicht immerzu unschuldige Passanten Bälle an den Kopf bekommen und die üblichen Millionenforderungen stellen. Müsste man nicht beim Betreten des Parks ein Papier unterschreiben, in dem man von Forderungen solcher Art pauschal absieht und sich zum Spaziergang auf eigene Gefahr bereit erklärt? Ich verstehe Amerika nicht. In der hohen Lobby des Museums begrüßt dich ein monumentales Werk von Anselm Kiefer, bedeutungsschwer und unerträglich wie nur je, das helfen der Park nicht draußen, und die Sonne, und nicht St. Louis. In einem der wenigen Reiseführer, die es gibt, stand auch, es handle sich um eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Vereinigten Staaten. Wohl nicht sehr übertrieben. Es gibt einen Saal mit späten Monets und einen mit späten Beckmanns, einen mit deutschen Malern der Moderne von Kirchner bis Nolde und Macke. Unweit die amerikanische Kunst seit den Sechzigern, Warhol und Rothko, Close und Judd. Es ist alles da. Sieben wunderhübsche kleine Bilder quer durch alle Schaffensperioden von Klee sind in einen Zwischenraum mit Treppenaufgang gezwängt. Ein Cézanne, ein Van Gogh, man beginnt sich die ganze Kunst als Volk ohne Heimat vorzustellen, in der ganzen Welt anzutreffen und nirgends zuhause. Von den wenigen Verrückten abgesehen, die Kunsthistoriker sind und Reisen unternehmen nach überallhin, bekommt man sie versammelt nur bei Großausstellungen zu sehen, zu denen die Bilder und Werke wie VIPs und mit nur durch Staatsgarantieren bezahlbaren Versicherungen an einen auch wieder beliebigen Ort eingeflogen werden alle Jahrzehnte mal und sich gegenseitig grüßen wie alte Bekannte, von Tausenden begafft werden und dann geht es zurück nach, sagen wir, Kansas City oder St. Louis. Fragt ein van Gogh den anderen: Und wie ist es so in der Neuen Welt? Seufzt der: Habe neulich einen Golfball an den Kopf bekommen. Eine Sonderausstellung ist den piktorialistischen Fotografen gewidmet, die in den Jahren von circa 1890 bis zum ersten Weltkrieg alles daransetzten, die Fotografie der Kunst anzunähern. Das ist sehr buchstäblich zu verstehen, denn durch den Einsatz von sehr speziellen Edelpapieren, Farbtricks und Manipulationen auf allen Ebenen der Bildentwicklung sehen die misslungensten dieser Fotografien aus wie schlechte Amateurgemälde. Immerhin sind sie als Fotos kaum mehr zu erkennen. Der Widerwille, den ich beim Betrachten dieses Umgangs mit dem Medium habe, ist mir nicht ganz geheuer, weil es mir umgekehrt auch widerstrebt, das dokumentarische Moment der Fotografie allzu sehr zu übersteigern. Aber was die (mit einer Ausnahme) Herren hier anstellen, scheint einfach medial unsinnig, ausser da, wo es wieder eindeutige Anleihen an der Avantgarde nimmt, mit Montagen und Annäherungen an die Abstraktion. Interessant ist die Bewegung wohl genau aus Kreuzung aus Avantgarde (es gibt eine Picasso nachahmende Fotografie und ein Bild von Nijinski im apres midi d`un faune) und der reaktionären Orientierung an einer letztlich doch die Darstellung der Welt figurativ, im Zweifel idyllisch buchstabierenden, soeben überholten Malerei. Es ist sehr folgerichtig, dass der Piktorialismus keine Zukunft hatte. Die Texttafeln zur Ausstellung beschwoeren ein ums andere Mal die Schoenheit dieser Bilder. Dabei ist gerade die das Dubiose daran. Es folgt nach dem Museum eine Odyssee auf der Suche nach einem Mitbringsel für meinen Gastgeber in Chicago, einer Flasche Scotch, aber ich verzweifle darüber. In der Galleria-Mall, zu der ich mich mit die MetroLink-Verbindung ersetzenden Shuttle-Bussen irgendwann durchgeschlagen habe, gibt es keinen einzigen Laden, in dem sich dergleichen findet. Wenige Schritte weiter – na sagen wir, eine halben Kilometer, die Maßstäbe verändern sich schnell – ein weiteres Einkaufszentrum, mit Wholefoods und der kleineren, billigeren Variante des Ökomarkts Trader's Joe, mit einem Target-Supermarkt und einem großen Laden für Tierbedarf und diesem und jenem: nichts, nirgends eine Möglichkeit, Liquor zu erwerben. Der Bus fährt dann nicht von der einen Haltestelle, sondern von der anderen. Ich verpasse ihn und der nächste kommt eine Stunde später. In der Zeit schlendere ich durch die Mall, die jetzt, kurz nach sieben am Abend, während es draußen rasch dunkel wird, sehr belebt ist, in der in den Läden, die man in dieser wie jeder Mall findet, die amerikanischen Menschen ihre Kleidung kaufen und ihre Nahrung zu sich nehmen und für die Kids sündteures Spielzeug in einem der Discovery-Channel-Geschäfte erwerben. Selten habe ich mich in einer Mall so fremd gefühlt. Es ist alles unendlich vertraut und ganz weit entfernt. Wie war es so in der Neuen Welt? Habe den Bus verpasst und schreckliches Heimweh nach Europa verspürt. ... Link Donnerstag, 30. März 2006
kansas city
knoerer
17:58h
Nähert man sich Kansas City von Norden, wie ich es getan habe, vom Flughafen kommend, fährt man durch Industriegelände erst und sieht dann den Missouri-River, der träge und ohne alle Pracht an die Stadt weniger sich zu schmiegen scheint, als dass er sie, in der Annäherung sich abwendend, meidet. Man quert ihn über eine mächtige Brücke, denn er ist träge, aber breit, und stößt dann auf einen Felsen. Von dieser Seite her ist Kansas City wie eine Festung, auf einem Felsen erbaut. Hier, am Nordende, ist die Main Street in Downtown eine Schlucht zwischen jäh ansteigenden Hügeln. Auf dem Hügel des Ostens liegt mein Hotel. Es ist hellocker verputzt, hat etwas von einer Kaserne und bröckelt. Der Portier sitzt hinter Glas, alles ist sehr schmucklos. Im Aufzug aus hässlichem und hässlich abeblättertem dunklen Holzfurnier ächzt die Deckenlüftung, es stinkt wie auf der Fähre von Bari nach Patras. Der Gestank im mit Auslegeware ausgelegten Zimmer ist süsslicher, aber mindestens ebenso penetrant. Im Zimmer gibt es: einen Fernseher, ein Bett, einen Tisch, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, einen Sessel, zwei Lampen und eine Kommode. Die technischen Geräte funktionieren, die im nicht mehr ganz sauberen Prospekt versprochenen HBO-Pay-TV-Programme finden sich allerdings nicht unter den Fernsehprogrammen. So habe ich leider "Big Love" nicht sehen können, die neue Serie um einen Mann in Salt Lake City mit drei Ehefrauen, darunter Jeanne Triplehorne und Chloe Sevigny. Die Mormonen legen Wert auf die Tatsache, dass sie die Vielehe bereits im Jahr 1990 abeschafft haben. Kansas City ist heute anzusehen, dass man die Stadt in wenigen Jahren kaum wiedererkennen wird. Natürlich werden die eindrucksvollen Art-Deco-Hochhäuser, die aus der Downtown-Schlucht ragen, nicht verschwinden; man ist sogar versucht zu sagen: niemals. Daneben aber, noch immer mitten im Zentrum, finden sich riesige Baustellen, von noch riesigeren Kränen bewacht. Es entsteht hier ein neuer Entertainment-District, mit Shops und Restaurants und womöglich sogar Kinos; letztere sind im Moment noch kaum zu Fuß zu erreichen. Und wer hat ein Bussystem je schon am zweiten Tag durchschaut? Freilich gibt es die Bus-Expresslinie MAX, die im wesentlichen nichts tut, als von Norden nach Süden zu fahren und wieder zurück. Am Tag meiner Ankunft habe ich einen Teil dieser Strecke, einen Weg nach Süden, zu Fuß zurückgelegt. Man kommt dabei durch den sogenannten Crossroads Arts District, ein Viertel, das, so lese ich, lange nicht mehr als Brache war, in dem sich nun aber viele kleine Galerien angesiedelt haben. Am First Friday, einmal im Monat, schwärmen die kunstbeflissenen Bewohner der Stadt durch diese Straßen, in die Galerien und die auch dort sich ansiedelnden Restaurants. Am Tag meiner Ankunft aber, an einem Nachmittag gegen Ende des Monats März, war von Leben im Crossroads District wenig zu spüren. Ebensowenig in der mit großem Aufwand renovierten Union Station, dem alten Bahnhof der Stadt. In einem kleinen Seitenflügel findet sich der Amtrak-Schalter, auch von und nach Kansas City fährt nur ein paar Mal am Tag ein Zug. Der Rest des Bahnhofs ist umgenutzt, eine Wissenschafts-Ausstellung für Kinder, Restaurants. An der Information in der Mitte des Saals sieht ein Mann sehr einsam aus und macht nicht den Eindruck, als würde er oft nach etwas gefragt. Über einen Skywalk kann man hinübergehen vom Bahnhof ins Crown-Center, eine Art Mall, in der freudlose Menschen, als ich dort bin, am späteren Nachmittag eines kühlen Märztags, eher freudlos Dinge tun wie essen und einkaufen. Zwischen Crown Center und Union Station auf einer Anhöhe das Liberty Memorial, das, wie ich lese, einzige dem Ersten Weltkrieg gewidmete Mahnmal in den USA. Es ist riesig, nicht so trutzig und auch nicht gar so hässlich wie das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig – die Dimensionen aber sind ähnlich. Ich belasse es bei dem Blick aus der Halbnahen und kehre mit dem MAX-Bus zurück in mein Hotel, in dem es nach wie vor stinkt. Es war mir nicht klar, aber diese Reise ist auch eine Reise zu einigen der besten Museen der Vereinigten Staaten. Der Arts District liegt im Süden der Stadt, rund um die 45. Straße. Von der zehnten, auf deren Höhe ich wohne, nach dort sind es bestimmt sieben oder acht Kilometer. Gäbe es den Bus nicht, ich gelangte nur mit dem Taxi dahin. Erst 1994 hat das Kemper Art Museum, das in einem mehr gewollten als gekonnten Proto-Liebeskind-Bau residiert, seine Tore geöffnet; die Sammlung ist nicht alt, aber von Geld, das man hat, zeugen ein kleiner Jackson Pollock und auch Andy Warhols "Dennis Hopper". Sehr schön sind die aktuellen Ausstellungen. Die eine gruppiert zwei junge amerikanische Künstler (Phoebe Washburn, Stephen Hendee) gegeneinander in einem großen Raum. Beide haben in diesen Raum Gebilde gesetzt, wuchernd, sehr organisch aus wellenförmig nach oben hin zu einer Art Rutsche zusammengeklopften Holzplatten das eine, streng zu eckigen, rätselhaften, schönen Wänden und Türmen und Formen aus Plastik und schwarzem Klebeband zusammengetüftelt das andere. In der Mitte ein Pingpong-Tisch, als Metapher des Kampfs zwischen beiden, mit Anspielung auf eine rund um ein Tischtennisturnier sich ereignende Annäherung zwischen China und den USA. Das war aber die Idee der Kuratorin, dafür können die Künstler nichts, die im Katalog denn auch gar nichts Dummes sagen. Auch die aus Acryl-Bildstücken zusammencollagierten Bilder des Kurt Lightner gefallen mir gut. Er kehrt mit ihnen als Künstler zurück in den Wald von Ohio in seiner Kindheit. Im engen Sinne figurativ sind die Gemälde nicht, denn Wald und lauter Bäume sieht man in einem aber schon, dahinter viel versprechend die bunten Schätze, die Lightner als Kind dort fand. Unterseeische anmutende Märchenwälder, dekorativ und gespenstisch. Auf dem Rasen vor dem Nelson-Atkins-Museum um die Ecke etwa vier Meter hohe Federbälle von Claes Oldenburg. Ich gehe hinein und wie so oft ist der Eintritt frei. Es ist eines der in den USA wohl nicht selten zu findenden Museen mit dem Anspruch, die Weltgeschichte der Kunst in bezeichnenden Ausschnitten zu repräsentatieren. Der Grundzug ist didaktisch, es gibt im Untergeschoss ein von Ford gesponsertes Learning Center, in dem sich Schulklassen austoben können. In der Tat sieht man eine Menge Kinder und Jugendliche, die sich beinahe interessiert zeigen an der Kunst. Ich gelange zunächst in den Barock-Saal, in dem "Johannes der Täufer" hängt, von Caravaggio, ein Bild, das fast völlig auf schwarz und weiß reduziert ist (mehr schwarz als weiß, denkt man) – auch Johannes ist aller Attribute entkleidet. Von Rubens ein Gemälde von eindrucksvoller Dynamik. Sehr staune ich über zwei Bilder von Alessandro Magnasco, den ich nicht kenne, und ihren überaus frechen, in fast überheblicher Virtuosität das Figurale dem Gekritzel annähernden Strich. Unter den Highlights der amerikanischen Kunst findet sich wahrlich Scheußliches, Indianer und Trails und Death Valley, daneben aber auch Blumen von Georgia O'Keeffe. Und in einer Sonderausstellung, die die Übergänge von Realismus und Abstraktion didaktisch aufbereitet, findet sich eines der dunklen Bilder Mark Rothkos, wie wir sie schon in der Rothko Chapel in Houston gesehen haben. Hingerissen bin ich aber vor allem von einer anderen Sonderausstellung zur chinesischen Kunst. Sie zeigt die Reaktionen der Maler auf das Ende der Ming-Dynastie. In den drei Jahrhunderten der Ming-Dynastie (von ca. 1350 bis 1648) steht die Malerei der Literati (wen-jen) in Blüte; es sind dies Künstler-Gelehrte mit genauer Kenntnis der Kunstgeschichte, die aber auch als Dichter hervortreten. Auf ihren Gemälden finden sich deshalb neben dem Figurativen auch Gedichte. Wenn ich recht verstehe, was ich gestern dazu gelesen habe, geht es gerade um die Übergängigkeit von Schrift und Bild. Die Gegenstände, die zu sehen und zu erkennen sind, bewegen sich bereits in Richtung Schrift. Viel hat das mit dem Zug des Pinsels zu tun, der ein- und derselbe ist im (kalligraphischen) Schreiben und im Produzieren des Bildes. Der bevorzugte Gegenstand der wen-jen sind daher - im starken Gegensatz zur Tradition, mit der es um 1350 einen recht radikalen Bruch gibt – Landschaften, die oft Fantasiegebilde sind, Felsen und Bäume und in den Hintergrund gekauerte Hütten aus Strichen. Im 17. Jahrhundert kommt es zu Radikalisierungen in der Abstraktion. Atemberaubend sind zwei Biler, in denen sich zwischen der weithin unangerührten Leere des Papiers nur ein aus zwei, drei dicken Strichen geformter Felsüberhang und ein Vogel finden. Ich bin, nachdem ich das Museum verlassen habe, in die Filiale der Stadtbibliothek gegangen, die nicht weit entfernt ist, und habe eine Stunde lang in einem Buch gelesen, das sich dort fand, einem Katalog zu einer Austellung, die das Nelson-Atkins-Museum einmal gemacht hat, mit dem Museum in Cleveland, zur chinesischen Malerei. ... Link Dienstag, 28. März 2006
panama
knoerer
03:24h
Hinausgefahren mit dem Red Train, ein Zwischending zwischen Straßen- und S-Bahn, die downtown quert und dann in die mittlere Ferne führt. An der Mockingbird Station ausgestiegen – beinahe aufs Geratewohl – und im Angelika Film Center gelandet. Daneben die Southern Methodist University, ein sehr grüner Campus, die Gebäude in einem Backstein in allen Schattierungen zwischen Rostrot und Dunkelbraun gehalten. Eine Privatuni, die sich Hoffnungen machen darf, von Präsident George W. Bush nach seinem Ausscheiden aus dem Amt die obligatorische Präsidentenbibliothek gestiftet zu bekommen. Vorne an der Mockingbird Avenue ist ein Barnes & Noble, der in seinen Regalen auch die Werke der Uni-Professoren führt. Es ist viel Belletristisches darunter. Ich schlendere durch den Gang mit den Reisführern, greife eher zufällig zu Frommers "Germany"-Führer, schlage ihn irgendwo auf und es öffnen sich die Konstanz gewidmeten Seiten. Ich trödle ein bisschen herum, schlendere über das Uni-Gelände – das seltsam verlassen ist, dafür dass immerhin 10.000 Studenten hier eingeschrieben sind – und gehe dann ins Kino. In der Mittagsvorstellung (1 Uhr 20) sind außer mir immerhin noch sechs Besucher. Überhaupt ist im Shopping-Bereich neben dem Kino gar nicht wenig los. Wie so vieles hier ist mir das ein komplettes Rätsel. Der Film, den ich sehe, ist "Unknown White Male" und erzählt die wahre Geschichte eines Mannes, dem im F-Train nach Coney Island mit einem Mal klar wird, dass er nicht weiß, wer er ist. Er hat eine totale Amnesie erlitten, der Regisseur ist ein früherer Freund, den Doug, der Held des Films, naturgemäß auch nicht mehr erkennt. Der Regisseur macht hier viel falsch, versucht immer wieder, mit dummen Effekten die subjektive Sicht Dougs zu reproduzieren. Das ist natürlich ein Unsinn. Doug aber ist faszinierend. Im Leben zuvor ein sehr erfolgreicher Broker, jetzt aber mit heftigen philosophischen Anwandlungen. Er ist nicht sicher, ob er die Menschen, die er früher mochte, immer noch mag. (Vor allem sein Vater ist ein Problem.) Er findet sich hinein in ein neues Leben. Seine Freunde sagen, er sei nicht mehr derselbe. Er schildert seine Entzückungen über all das Neue, das ihm begegnet ist. Am Ende ist er nicht sicher, ob er sich wirklich je wieder erinnern mag. Das West Transfer Center ist einer der beiden zentralen Bus-Umstiegsplätze von Dallas. Ich warte hier auf Bus Nummer 36, der mich zur im Reiseführer empfohlenen Highland Park Plaza bringen soll, einem Einkaufszentrum. Zwei Polizisten auf Fahrrädern stehen unter den Wartenden und beobachten aufmerksam, was geschieht. Wieder einmal bin ich der einzige Weiße. Ich denke mir, dass sich die Welten hier wirklich nicht begegnen, die Weißen in ihren protzigen Proto-Militärfahrzeugen, die Schwarzen auf den Straßen, in den Bussen, im Süden der Stadt. Wenn man Downtown Weiße sehen will, reiche Weiße, muss man sich schon vor dem Neiman Marcus-Kaufhaus – hier ist die Zentrale der Kette – an die Ampel stellen, die überqueren muss, wer ins Parkhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite will. Eine der wenigen Lichtungen, auf denen sich im Innern der Stadt dieses scheue Wild zeigt. Dann steige ich in den Bus Richtung Einkaufszentrum im Norden und komme bald aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es wird grüner und grüner und an den Straßenseiten sieht man Anwesen, für die das Wort Anwesen noch viel zu bescheiden ist. Eines ist ganz im modernistischen Stil gehalten, daneben eine Art Edel-Scheune mit sehr hoher Mauer drumrum. Und so etwas wie die Highland Park Plaza habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte mit einer Art Mall gerechnet, aber es ist eine in Hufeisenform angelegte Shopping-Piazza. Ganz vorne gleich Chanel. Davor eine weiße Dame im sehr teuer aussehenden Kostüm, das Handy am Ohr. Alle hier sehen reich aus. Ich sehe BMWs, Porsches, Mercedes, zwischendurch ein Humvee. Am ehesten erinnert mich das in seiner abgeschottteten Eigenweltlichkeit ans Nikolaiviertel, wenngleich das hier von jedem Interesse an der Imitation von irgendwas befreit ist. Edelladen an Edelladen. Edelhausfrau neben Edelhausfrau. Alle telefonieren, alle sind bestens gekleidet. Das ganze Gelände wird von Musik beschallt, Wiener Klassik. Ich kaufe schnell etwas zu essen im Delikatessen-Supermarkt Tom Thumb. Hier sehe ich den einzigen Schwarzen, er bedient mich an der Kasse. Als ich es mit meiner Antwort aufs übliche "How are you doing today" konsterniert am gleichfalls üblichen Enthusiasmus fehlen lasse, fragt er zweimal nach. An der Bushaltestelle vor der Plaza warten nur die Reingungskräfte. Neben mich auf eine Bank setzt sich ein hispanisch aussehender Mann. Gemeinsam beobachten wir, wie ein älterer Herr mit teurem Auto einparkt und aussteigt. Seine Frau bleibt auf dem Beifaherersitz sitzen. Er beugt sich tief in den Kofferraum und holt einen Stock heraus. Es ist kein Spazierstock, dafür ist er zu krumm und kurz. Mit dem Stock in der Hand geht der Mann davon. Die Frau bleibt sitzen. Der Mann neben mir und ich, wir blicken ihm nach, wir müssen beide lachen. So kommen wir ins Gespräch. Er stammt aus Panama, lebt seit fünf Jahren in Dallas und sucht einen Job als Kellner. Deswegen ist er in der Plaza gewesen. Wir sprechen über die Fußball-WM. Ich sage, das deutsche Team ist schlecht. "You never know", sagt er mit seinem sehr starken Akzent. Wir sprechen über deutsche Autos, VW, BMW, Audi, Mercedes zählt er auf. Er will nicht glauben, dass das Benzin bei uns viermal so teuer ist wie in den USA. Während wir sprechen, fahren fünf Jaguars, ungezählte Mercedesse und BMWs und ein Rolls Royce auf der Straße an uns vorbei. Nach ein paar Minuten kommt der ältere Herr wieder. Er hat den Stock immer noch in der Hand, er legt ihn zurück in den Kofferraum, die Frau sitzt noch immer auf dem Beifahrersitz. Der Mann aus Panama und ich, wir sehen uns an und lachen wieder. "Strange", sage ich. Er nickt, dann kommt der Bus. ... Link Montag, 27. März 2006
reisetagebuch: dallas/fort worth
knoerer
17:31h
27.3., 9.30 am Es gibt eine schnelle, alle zwanzig Minuten verkehrende Zugverbindung zwischen Dallas und Fort Worth. Aber nicht am Sonntag. Da fährt sie nicht seltener, sondern überhaupt nicht. Es ist ein Pendlerzug und am Sonntag ist Dallas von Fort Worth für den, der kein Auto hat, einfach abgeschnitten. Ich wollte aber gestern nach Fort Worth, weil heute die Museen geschlossen haben, und nur der Museen wegen wollte ich da hin. Amtrak kann man in diesem Zusammenhang vergessen, aber es gab eine Alternative: "Greyhound" mit immerhin vier Bussen auch am Sonntag. Also bin ich in die Stadt gegangen, zu Fuß, auf Wegen, die kein Stadtplaner je vorgesehen hat. (Aber es kommt nicht darauf an, was die Stadtplaner vorsehen, sondern was sie zulassen.) Alles menschenleer, drei Jogger begegnen mir auf einer abgesperrten Straße, die nirgendwohin führt. Auch eine Katze. Sie schwingt sich einen Hügel hinunter, unten befindet sich das American Airlines Center, in dem die Mavericks Basketball spielen. Ich gehe hinein in die Stadt, auf einer Baustelle sind ein paar Arbeiter zugange, Mexikaner. Die Sonne scheint, es ist warm. Die "Greyhound"-Station liegt downtown. Ich betrete sie, hier ist Leben. Unter den vielleicht fünfzig Menschen hier bin ich einer der ganz wenigen Weißen. Vor mir in der Ticket-Schlange ein Hispano-Amerikaner, der mich um einen Stift bittet für das Namens-Schild, das an jedem einzucheckenden Gepäckstück zu befestigen ist. Er schreibt seinen Namen auf das Schild, zeigt es mir, sieht mich fragend an, die krakeligen Buchstaben machen klar: Er ist niemand, der mit dem Schreiben viel Übung hat. Mein Bus fährt in drei Stunden, ich gehe zu Fuß durch die Innenstadt, die nach wie vor wie ausgestorben ist. Sie ist hübsch, gepflegt, kleine, sehr korrekt gemähte Grünflächen und Parkplätze wechseln sich ab. Im "Dallas Observer", dem alternative weekly, das man umsonst aus entsprechenden Verteilern entnehmen kann, lese ich wenig später von den Säuberungsbemühungen der Stadt. Damit einher geht die Vertreibung der Obdachlosen, in einer einschlägigen Untersuchung ist Dallas zur sixth meanest city der USA erklärt worden, weil sie alles unternimmt, den Obdachlosen das Leben schwer zu machen. Unter der I-35 gibt es ein kleines Karton-Dorf, das regelmäßig niedergewalzt wird, obwohl es unter der Autobahn wenige Nachbarn gibt, die Grund zur Beschwerde haben. Mein Bus ist nicht einmal halb voll, als er startet. Ich bin, soviel kann ich sagen, der einzige Tourist an Bord. Die vorherrschende Farbe des Gepäcks ist, anders als auf Flughäfen, nicht schwarz. Das Gepäck ist bunt, es sind auch Tüten darunter. Der Bus hält zweimal, in einem Kaff namens Irving, in dem ich nur Schwarze und Hispanics auf den Straßen sehe. Dann in Arlington. Hier ist eine lange Schlange von der Autobahn-Ausfahrt, denn hier befindet sich, von der Straße aus zu sehen, ein riesiger Vergnügungspark, Six Flags over Texas, mit einer Achterbahnkonstruktion, die sich auf Eisenstangengespinsten zu Berg und zu Tal schwingt. Die "Greyhound"-Station in Fort Worth ist kleiner als die in Dallas, auch sie liegt downtown. Ich mache mich auf den Weg ins Museumsquartier, das auf meiner Karte im Dumont-Führer nahe zu liegen scheint. Das täuscht. Die mindestens drei Kilometer, die ich zu gehen habe, würde auch der Europäer nur zögernd als fußläufige Entfernung bezeichnen. Natürlich sehe ich außer mir keine Fußgänger, nur ein paar Jogger in einem Park, den ich auf einer Autobrücke überquere. Es ist sonnig und warm, aber nicht heiß. Rechter Hand liegt ein riesiges Einkaufszentrum, Montgomery Plaza, ich sehe viele Autos davor, aber keine Menschen. Die Straße führt immer geradeaus und nach einer halben Stunde bin ich da. Von Louis B. Kahn stammt der Entwurf für das Kimpbell Art Museum, eine der erlesensten Privatsammlungen der USA. Es ist ein Bau von ganz makelloser funktionaler Schönheit. Dem Zweck, dem es dient, so perfekt angeschmiegt, dass es ihn gerade dadurch transzendiert. Gar nicht fotogen von außen, aber im Inneren bereitet es den Werken das mildeste natürliche Licht. Zwei Längsschlitze in der Decke, das Licht wird aber noch einmal gefiltert durch eine davor gehängte Konstruktion. Allein für George de la Tours Falschspieler lohnt der Besuch – getrennt durch einen Frans Hals hängt das Vorbild von Caravaggio gleich daneben. Die Farben bei de la Tour strahlen im natürlichen Licht von Louis B. Kahn. Daneben vieles, das Rang und Namen hat, ein wunderschöner Murillo, Rembrandt, Rubens, Velazquez, es ist alles da. Unten hängen auch atemberaubende japanische Tuschezeichnungen. Die Texte zu den Bildern sind klug. Der Eintritt ist, wie in der Menil Collection in Houston, frei. (Nicht der zur Sonderausstellung zu Gauguin und den Impressionisten, die ich mir spare.) Allerdings ist das hier nicht so aus der Welt gefallen wie das Gelände in Houston, schon weil es hier große Parkplätze gibt, weil das ein Museumsquartier ist, wie man sie an vielen Orten der Welt finden kann. Nebenan das erst 2002 fertig gestellte Modern Art Museum, ein seltsam transparenter Traum aus Beton und Glas und Wasser von Tadao Ando. Hohe Räume, innen alles aus Beton mit regelmäßgen runden Vertiefungen, wenige Zentimeter breit und tief. Aber keineswegs der Eindruck von Schwere. Oft geht man um eine Ecke und hat überrascht einen Ausblick auf die Wasserfläche, die zur vom Eingang abgelegenen Seite hin das Gebäude umgibt. Sehr schön ist es, den Blick auf die noch nicht fertig gehängten Bilder von Chuck Close zu erhaschen, sich formende, zergehende Porträts. Gesichter, die sich ins Unklar auflösen. Saal um Saal mit den bunten, abstrakten rechteckgefüllten Rechtecken von Sean Scully. Als ich lese, dass Scully seine auf den ersten Blick immer ähnlichen Bilder an ganz unterschiedlichen Orten malt (New York, Barcelona, ein Kaff bei München mit Blick auf die Alpen), beginne ich nach Stimmungsunterschieden zu suchen und finde sie. Ein ganzer Raum (es ist viel, viel Platz hier, alles ist sehr großzügig hier) ist Nicholas Nixons Zyklus "The Brown Sisters" gewidmet, einer Fotoserie, die auf dem außerordentlich einfachen Prinzip beruht, jedes Jahr ein Foto derselben vier Schwestern zu machen, darunter die Frau des Künstlers. (Man erfährt aber nicht, welche der vier es ist.) Ich beginne mit dem ersten Bild, 1975 aufgenommen, und schreite Jahr für Jahr in die Zukunft, das heißt an die Gegenwart heran. Man kann der Zeit bei der Arbeit zusehen, dem melancholischen Blick ist es eine Arbeit der Vernichtung. (Und muss der Blick hier nicht melancholisch werden?) Jugend und Schönheit der Frauen verschwinden Zug um Zug, ein leises Vor und Zurück, aber als ich nach dreißig Jahren – das letzte Bild ist von 2005 - wieder zurückkehre zum strahlenden Anfang, bin ich den Tränen nah. Die Bilder, die das Museum angekauft hat, füllen rundum den ganzen großen leeren Saal. Da Nixon weiterarbeitet, werden sie wohl Jahr für Jahr umgehängt werden müssen, näher aneinander heran. Irgendwann wird die erste sterben. Oder der Künstler. Ich gehe, wieder zu Fuß, die drei, vier Kilometer zurück in die Stadt. Der Platz im Zentrum von Fort Worth heißt Sundance Square, und zwar tatsächlich nach dem Westernhelden Sundance Kid. Um dieses Zentrum herum finden sich Restaurants, Läden, beinahe so etwas wie Leben; das also, was man im Zentrum all dieser großen amerikanischen Städte eigentlich nicht recht findet. Heute, am Sonntag, ist auch hier nicht sehr viel los. Bei Barnes & Noble lese ich eine ganze Weile in den Stadtführern zu Kansas City und St. Louis und freue mich darüber, dass ich mich darauf freue, diese Woche dann dort zu sein. Bei "Greyhound" wieder eine ähnliche Mischung von Kunden, ich habe diesmal einen Expressbus, der nicht hält zwischen Fort Worth und Dallas. Es ist jetzt dunkel draußen, es gibt Licht an den Plätzen, aber keiner schaltet es ein. Niemand liest, also lasse auch ich es bleiben und blicke hinaus, auf die Lichter der amerikanischen Großstädte und die Lichter dazwischen. Die Achterbahn von Six Flags over Texas ist zum Teil erleuchtet. Riesige Strahler vor zwei Auto-Geschäften, im Licht glänzt der Lack von hunderten von Autos in der texanischen Nacht. Die Wolkenkratzer von Downtown-Dallas sind mit grünen und weißen Lichtstreifen verziert, ein kugelförmiges Wahrzeichen ist bei Nacht einfach eine Kugel aus Licht. Wieder fahren wir an der Stelle des Attentats auf JFK vorbei. Keines der Taxis, die ich winke, hält an. Der Trick ist, sich vor eines der Edelhotels in der Innenstadt zu stellen. Dort halten sie an oder stehen sie bereit. Ich fahre in mein Hotel im Schatten des World Trade Center von Dallas, ich lese noch in "Krieg und Frieden" (Pierre hat gerade ein riesiges Vermögen geerbt). Mitten in der Nacht wache ich auf, weil aus einer Steckdose Radiogeräusche kommen. Das klingt verrückt, ist aber so. Ich stecke eines der drei Kopfkissen davor, der Lärm ist gedämpft. Ich quetsche meinen Kopf zwischen die zwei anderen Kopfkissen und schlafe ein, obwohl ich die Geräusche noch immer höre. Als ich aufwache, sind sie verschwunden. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8761 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

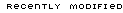
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||