
 |
... Vorige Seite
Dienstag, 11. Februar 2003
Son Frère (Patrice Chéreau, F 2003)
knoerer
20:38h
"Intimacy", Patrice Chereaus Berlinale-Gewinner von 2001, war ein Film über die Nähe, die entsteht, wenn zwei wildfremde Menschen außerhalb aller gesellschaftlicher Bindungen im Sex, also über ihre Körper zueinander finden. Mit "Son Frere" setzt Chereau seinen Erkundungen über menschliche Körper und menschliche Bindungen fort - und radikalisiert sie. Es geht diesmal nicht um Sex und nicht um Fremde, sondern um das noch viel intimere Verhältnis zwischen den zwei einander lange entfremdeten Brüdern Luc (Eric Caravaca) und Thomas (Bruno Todeschini), die durch die Krankheit des einen zu einer ihnen zuvor ganz unbekannten Nähe finden. Thomas' Körper ist buchstäblich von der Auflösung bedroht. Seine Blutplättchen verschwinden, aus Gründen, nach denen die Ärzte suchen, die sie aber nicht finden. Diese Krankheit ist mit Bedacht gewählt: die Blutplättchen sind für die Abdichtung des Körpers nach außen zuständig, sie verhindern das Ausbluten, indem sie an den Bruch- und Schnittstellen einen Damm errichten, einen Schutzwall. Sie sind quasi der letzte Halt des Individuums, indem sie seine Außengrenzen sichern. Dieser Schutz bricht für Thomas zusammen, jede Blutung kann ihn töten. In seiner Not sucht er seinen Bruder auf, verspricht sich Halt von ihm und Hilfe. Damit ist das grundlegende gesellschaftliche System zur Ordnung des Zusammenlebens ins Spiel gebracht, die Familie. Es ergeht den Brüdern aber wie Thomas' Körper: die Grenzen und Barrieren, die sie seit der Pubertät getrennt haben, lösen sich auf. Luc wird zur sorgenden Mutter, zum besten Freund, beinahe zum Liebhaber seines Bruders, ein Muster symbiotischer Fürsorge für den todkranken Thomas. Die Intimität, die entsteht, ist ungeheuer - viel ungeheurer als die, die der Sex in "Intimacy" herbeigeführt hat. Und sie ist nicht weniger eine Sache der Körper, der Bloßstellung des kranken Körpers und der Reduktion des Menschen in der Krankheit auf seine hinfällige Körperlichkeit. Chereau inszeniert diese Annäherung sehr schlicht, mit viel Handkamera, den Blick immer auf die Gesichter der Brüder gerichtet - und, das ist die Hauptsache, niemals abwendend vom Elend der Versehrungen, die die Krankheit anrichtet - und sei es in den zunehmend verzweifelten Heilungsversuchen der Ärzte. Der Höhepunkt, fast zehn atemberaubende Minuten lang, ist die Vorbereitung auf eine Operation. Es geschieht nicht mehr als die Rasur von Thomas Achseln, seines Oberkörpers, der Schamhaare durch zwei ganz sachlich vorgehende Schwestern (das Geschlecht ist durch ein Tuch schamhaft verdeckt). Der Blick der Kamera auf dieses Geschehen ist von faszinierender Selbstverständlichkeit, hat mit Voyeurismus nicht das mindeste zu tun. Es ist auch der Blick Lucs, der immer anwesend bleibt, wenig spricht, sich aufopfert als letzter Hüter seines Bruders. Den Grund benennt er selbst sehr schlicht: es ist nicht Liebe und nicht Pflichtbewusstsein. "Du hast mich um Hilfe gebeten, also helfe ich dir." Eine Selbstaufopferung, die nicht ohne Folgen bleiben wird, die ein Leben aus der Bahn wirft. Davon aber, von den Leben außerhalb dieser Beziehung, erfahren wir kaum etwas, nur Thomas' bald überforderte Freundin und Vincent, Lucs Liebhaber, kommen ins Spiel, Luc wird Vincent am Ende verlassen. Erzählt ist "Son Frere" auf zwei Zeitebenen. Die Gegenwart ist der Aufenthalt der Brüder an einem Rückzugsort am Meer. Thomas hat alle Behandlungsversuche aufgegeben, bereitet sich auf den Tod vor. In Rückblenden erfährt man die Vorgeschichte, die Annäherung der beiden, dieser Teil spielt vor allem im Krankenhaus. Mit zwei Ausnahmen verzichtet Chereau auf den Einsatz von Musik - umso eindrucksvoller die entrückt wirkenden Szenen, die mit einem der wunderbar pathetischen Songs von Marianne Faithful unterlegt sind: Hier lösen sich die Grenzen in einem Traumbild endgültig auf, die Brüder scheinen eins fast bis zur Ununterscheidbarkeit für den Augenblick. "Son Frere" ist der erste große Film des Wettbewerbs. ... Link
Confessions of a Dangerous Mind (George Clooney, 2002)
knoerer
20:37h
"Confessions of a Dangerous Mind" beschert einem gleich zwei Festival Déja-Vus. Der zweite Beitrag des neuen Hollywood-Drehbuch-Stars Charlie Kaufmann (nach "Adaptation") und der zweite Film mit George Clooney (nach "Solaris"), der hier zudem sein Regie-Debüt abliefert. Die Geschichte, die erzählt wird, ist so abstrus, dass Charlie Kaufmann, der Experte fürs Absurde, sie hätte erfinden müssen - wäre sie nicht wahr. Es ist die Geschichte von Chuck Barris, der in den USA berühmt wurde als Erfinder von Fernsehshows wie "The Dating Game" ("Herzblatt" ist die deutsche Version") oder "The Gong Show", in der sich Menschen ohne Talent vor einem Publikum ohne Gnade lächerlich machen durften. Allein das wäre als Vorgeschichte neuerer Trash-TV-Auswüchse, vielleicht schon einen Film wert: und der steckt auch in "Confessions of a Dangerous Mind", neben vielen weiteren. Das Drehbuch beruht auf der Anfang der achtziger Jahre erschienenen "unautorisierten Autobiografie" von Chuck Barris - die damals für alle belegte, dass er komplett durchgeknallt sein musste. Denn er behauptete, neben seinem öffentlichen noch ein verborgenes Leben geführt zu haben, all die Jahre, und zwar als Killer im Auftrag des CIA. Seine Ausflüge mit den "Herzblatt"-Gewinner-Paaren, nach Helsinki oder West- und Ost-Berlin zum Beispiel, waren vor allem Cover für Aufträge, die er nachts erledigte, mit der Waffe. Bis heute weiß keiner recht, ob etwas Wahres dran sein könnte, an diesen autobiografischen Fabulationen - Barris' Auskunft immer nur: kein Kommentar. Die Frage nach der Wahrheit aber, das wundert einen nicht, interessiert Charlie Kaufman kein bisschen. Clooney inszeniert das ganze nach der Drehbuchvorgabe als Bilderbogen eines verrückten Lebens, als Biopic der nicht so ganz gewöhnlichen Sorte. Ineinander gemischt werden unter anderem die Geschichte von Aufstieg und Fall der TV-Legende, ein Zeitporträt und ein Agententhriller mit finsteren Hintermännern (vor allem Barris' Auftraggeber Jim Byrd, den George Clooney spielt) und dunklen Hinterfrauen (großartig: Julia Roberts als femme fatale in Diensten der Agentur). Das Problem: "Confessions of a Dangerous Mind" ist das alles in einem und nichts davon richtig. Es handelt sich um die von George Clooney mit - allerdings vor allem bei Joel & Ethan Coen entliehener - Bravour inszenierte Schlachteplatte eines Lebens, um Herzblut an Fernsehmüll, Leichen auf Skiern zum Dessert. Seine heterogenen Bestandteile fliegen dem Film irgendwann um die Ohren, gerade weil sie in dem auf die Dauer ermüdenden einheitlichen Ton absurder Amüsiertheit vorgetragen werden. An vergnüglichen Momenten herrscht dabei kein Mangel, dafür sorgen Kurzauftritte von Brad Pitt und Matt Damon ebenso wie die virtuose Darstellung der Titelfigur durch Sam Rockwell. Abgründe aber werden nur behauptet, die Geschichte einer Ehe, die natürlich auch noch erzählt sein will (Drew Barrymore als Penny), verliert sich im Episodischen. Ja, im Grunde gilt das für den Film als ganzen. Das übliche Problem der Kaufman-Drehbücher zeigt sich auch hier, der Struktur, die durchs Biografische vorgegeben ist, zum Trotz. Man weiß nicht, wohin all die Absurditäten führen sollen, staunt nur, dass die reizendsten Einfälle aus dem Nichts kommen und dort auch wieder verschwinden. Was den Kaufmanschen Gaukeleien stets fehlt, ist die Notwendigkeit. Stattdessen flüchten sich seine Bücher von einer Skurrilität in die nächste, alle Hoffnung auf einen Sinn des Ganzen bleibt unerfüllt. Zuletzt ermüdet man, nur noch erschöpft vom dauernden Ansturm des Amüsanten. Schade drum, bei aller Großartigkeit im Detail. "Confessions of a Dangerous Mind" ist, was er, ginge es mit rechten Dingen zu, zuallerletzt sein dürfte: ein ermüdender Film. ... Link
La Fleur du Mal (Claude Chabrol, F 2003)
knoerer
07:07h
Chabrols neuer Film dreht sich um ein paar der ältesten Dinge der Welt: Vatermord und Inzest, Ehebruch und ein paar andere Schweinereien. Alles bestens bekannt, wenn nicht aus der griechischen Tragödie, dann aus den Filmen von Claude Chabrol. Zur Tragödie freilich reicht es bei Chabrol nicht, das gibt das Milieu nicht her, in dem er sich, hier wie fast immer, bewegt: das französische Bürgertum. Die Schauplätze, auf denen die "Blume des Bösen" (keine tiefere Beziehung zu Baudelaire, versichert Chabrol auf der Pressekonferenz, nur ein schöner Titel) blüht, sind das große Landhaus der Familie Charpin-Vasseur, ein Dorf, dessen Bürgermeisterin Ann Charpin-Vasseur werden will, eine Apotheke, die Gérard Vasseur, dem Vater gehört, ein kleiner Feriensitz am Meer, in dem Michèle, Annes Tochter, und Francois, Gérards Sohn, zum ersten Mal miteinander schlafen. Francois, damit beginnt der Film (nach einem kurzen Prolog), ist soeben von einem dreijährigen US-Aufenthalt zurückgekehrt, durch den er dem erstickenden Milieu entkommen wollte. Vergeblich, das zeigt sich sofort. Sie sind keine Geschwister, Michèle und Francois, sondern Cousins (wenngleich, nun, zu viel darf man nicht verraten...), aber sie verfallen, ohne es recht zu wissen, jenem Wiederholungszwang, der das Geschehen in "La Fleur du Mal" regiert. Der Film beginnt mit dem Blick auf eine Leiche, die Kamera zieht sich in einer kontinuierlichen Einstellung langsam über die Treppe des Landhauses zurück; die Handlung kann beginnen. Am Ende wird über dieselbe Treppe eine Leiche hinauf transportiert, auf dieselbe Weise drapiert wie im Anfangsbild zu sehen. Jedoch: es ist nicht derselbe Tote, die Tragödie, von der wir als vergangener hören, wiederholt sich als Farce, die wir als gegenwärtige sehen. Es wäre nicht übertrieben, wollte man behaupten, Chabrol habe hier seine Geschichtsphilosophie des Bürgertums verfilmt. "Zeit vergeht nicht", sagt er im Programmheft, "sie ist eine immerwährende Gegenwart." Eine Gegenwart, die die Verbrechen der Vergangenheit wiederholt, ohne es zu wissen. Heuchler waren wir, alle miteinander, von Anbeginn der Zeiten, meint Francois einmal, Heuchelei ist ein anderes Wort für Zivilisation. Von der Ironie, mit der die Geschichte ihr Spiel mit den Menschen treibt, bekommt nur etwas mit, wer den Blick weitet, wie Chabrol es tut mit der zentralen Figur seines Films, auf die Folge der Generationen. Diese zentrale Figur ist Tante Line, die Tante von Ann, sie soll, heißt es, ihren Vater ermordet haben, einst, am Ende des Zweiten Weltkriegs, weil er mit den Nazis kollaborierte, weil er seinen Sohn töten ließ, der sich der Résistance angeschlossen hatte. Tante Line ist der Angelpunkt, an dem Vergangenheit und Gegenwart zusammenhängen, sie kann, als sie die zweite Leiche sieht, die der ersten so sehr gleicht, nur lachen. Ein Nietzscheanisches Gelächter, in dem der Sinn der Geschichte, die Hoffnung auf einen Fortschritt, auf Veränderung überhaupt, verlacht wird. Tante Line wird von ihrer Familie als Heilige verehrt, auch der Betrachter schließt sie sofort ins Herz. Erfährt man am Ende, was eigentlich geschah, was sie getan hat, sollte einem eigentlich Hören und Sehen vergehen. Das tut es nicht, die Sympathie bleibt ungebrochen. Mit Tante Line, könnte man sagen, hat Chabrol seiner subversiven Sicht der Dinge eine Verkörperung gegeben, mit ihr gewinnt die Verwirrung der moralischen Maßstäbe eine verehrungswürdige Gestalt. Im Ton ist "La Fleur du Mal" von denkwürdiger Zurückhaltung. Mit manchmal provozierender Geduld entfaltet Chabrol sein Panorama des Bürgertums, die Grundierung der Vorgänge ist ein schwarzer Humor, der in der Darstellung des Absurden gelegentlich beträchtliche Komik entwickelt. Es gilt für Chabrol, was er für die Verwicklungen des Bürgertums behauptet: Es gibt nichts Neues unter der Sonne, immer dieselben alten Geschichten. Die jüngste Version, "La Fleur du Mal", aber gehört zu den überzeugenden unter Chabrols Variationen des einen Themas. Die Reize des Films liegen nicht immer an seiner Oberfläche, die Ironie der Geschichte spielt sich eher hinter dem Rücken der Beteiligten ab als davor. Dies aber zu zeigen, maliziös wie in seinen besten Werken, ist Chabrol hier gelungen. ... Link Montag, 10. Februar 2003
196 bpm (Romuald Karmakar, Deutschland 2002)
Reuthebuch
15:06h
Love Parade Wochenende in Berlin. Regisseur Romuald Karmakar zieht mit seiner kleinen Digitalkamera los um seine Eindruecke einzufangen. Der Film ist in drei Einstellungen unterschiedlicher Laenge gegliedert. Es beginnt mit dem Eingangsbereich eines Clubs in der Westberliner City, der an die 5 Minuten lang mit kaum bewegter Kamera beobachtet wird. Vor dem Laden auf der Strasse stehen ein paar junge Leute herum, tanzen, trinken, gucken, unterhalten sich, was man halt so macht. Es folgt eine aehnlich lange Einstellung an einem Kiosk. Einer trommelt gegen die Decke, zum Rhythmus der Musik, andere sitzen auf Bierbaenken. Der dritte und deutlich laengste Teil zeigt DJ Hell bei der Arbeit in einem Berliner Club. Das wars und mehr ist auch nicht. Auf der Toilette unterhaelt man sich noch mit einem Besucher ueber das Konzept des Films. Ziemlich Kulturpessimistisch, meint der, radikal selbstreferenziell noch dazu. Beide Aussagen koennte man so ohne Problem unterschreiben. Nach der Auffuehrung kommt Romuald Karmakar aufs Podium. Fast ein bisschen peinlich ist es ihm, dass sein Film einen Platz im Forum ergattert hat. Dabei gings ihm im letzten Sommer doch einfach nur ganz gut. So gut, dass er mal bei Pro Markt vorbeigestiefelt ist, fuer 25 Euro Material gekauft hat und losgezogen ist durch die Berliner Nacht. Kann ja auch durchaus Spass machen. Wer noch nie in einem Technoclub war oder die Love Parade nur vom hoeren sagen kennt, bekommt vielleicht sogar ein wenig einen Eindruck von dem was Techno ausmacht. Richtig auch, dass die Fernsehformate nicht befriedigen koennen, wenn es darum geht, unverfaelschte Eindruecke zu vermitteln.Ein Teil des Publikums findet es ganz witzig, wenn die Fragen des Festivalmitarbeiters ins Leere laufen und Karmakar achselzuckend die Absenz jeglichen Konzepts zugesteht. Zumindest ehrlich ist er. ... Link
My Life Without Me (Spanien/Kanada 2003)
knoerer
12:08h
Die 23jährige Ann, die sich mit Putzjobs über Wasser hält, zwei Töchter hat und einen Mann, der der einzige ist, mit dem sie je geschlafen hat, nachdem sie ihn mit 17 auf dem Nirvana-Konzert kennenlernte, Ann erfährt: sie wird sterben, bald, in zwei Monate oder drei. Keine ganz neue Geschichte, fast ein Genre: der Mann, die Frau, der oder die nicht mehr lange zu leben hat. Das Register, in dem das in der Regel erzählt wird, ist das Melodram. Viele Tränen fließen, während man der Hauptfigur beim Sterben zusieht. Nun wird man nicht sagen können, dass Isabel Coixets – übrigens von Pedro Almodóvars Firma „El Deseo“ produzierter, aber in Kanada gedrehter – Film kein Melodram ist. Das ist er schon, jedoch eins der eher leisen Töne. Es fängt damit an, dass man Ann gerade nicht sterben sieht, sondern leben. Und auch da vermeidet Coixet das Klischee. Es geht nicht in erster Linie um die Erkenntnis, wie wertvoll das Leben ist, wie wenig man es, im Alltag zum Tode lebend, geachtet hat. Ann nämlich lebt ihr Leben weiter, verrät keinem, wie es um sie steht. Das erste was sie tut: sie setzt sich in ein Café und macht einen Plan, eine Liste. Zehn Dinge, die sie tun will, bevor sie stirbt. Sex haben etwa mit einem anderen Mann als dem ihren, nur um zu wissen, wie es ist. Und Kassetten aufnehmen mit Geburtstagsgrüßen für ihre Töchter, bis sie 18 sind. Ihren Vater besuchen, der im Gefängnis sitzt, ein erstes und letztes Mal. Eine neue Mutter finden für ihre Kinder, eine neue Frau also für ihren Mann. Das erstaunliche ist nun, dass der Rest des Films nichts anderes ist als die Erfüllung dieses zu Beginn aufgestellten Plansolls. Punkt für Punkt arbeitet Ann, arbeitet der Film das ab. Im Waschsalon trifft sie Lee, einen George Eliot lesenden, etwas schüchternen, etwas verkorksten Landvermesser, sie haben Sex, sie verlieben sich ineinander. Im Nachbarhaus zieht eine junge, gut aussehende Frau ein, sie lässt sie die Kinder hüten und lädt sie zum Abendessen ein. Das klingt merkwürdig – und lässt einen doch erst in der Häufung ins Grübeln geraten, was die Regisseurin sich dabei gedacht haben mag. Im Detail nämlich der einzelnen Szenen, des häuslichen Alltags, des Kennenlernens, ist immer wieder die Dezenz Coixets zu bewundern, das Feingefühl, mit dem sie kaum je die Emotionen zur Sentimentalität überzieht. Der Hauptgrund, dass dieser Film nie wirklich auseinanderfällt, einem im Grunde sympathisch bleibt bis zum Schluss, ist die Hauptdarstellerin Sarah Polley – die ihre großartigste Rolle bisher in „Das süße Jenseits“ hatte, einem Film des Jury-Präsidenten Atom Egoyan. Zwar nimmt man ihr die Putzfrau keine Sekunde lang ab, ist im Gegenzug aber dankbar, dass ihr Spiel von allen Grobheiten frei ist, dass sie jede der vom Drehbuch gelegentlich mit allzu deutlichen Strichen gezeichneten Situationen mit einer Subtilität meistert, die, nicht weniger als das das, diesen Film rettet. „My Life Without Me“ ist ein netter Film mit manchen Schwächen. Den Goldenen Bären als beste Darstellerin hat sich, trotz Nicole Kidman, Sarah Polley beim gegenwärtigen Stand der Dinge verdient. ... Link
Goodbye, Lenin! (Wolfgang Becker, D 2003)
knoerer
11:40h
Das fatalste Missverständnis in Wolfgang Beckers beinahe katastrophal misslungenem Film "Goodbye, Lenin!" ist von der Art, die einem gar nicht sofort auffällt, weil man den Wald nicht sieht, nur all die Bäume – bis man dann merkt, dass es nur die Bäume gibt, gar keinen Wald. Soll heißen: Die DDR ist hier, von Anfang bis Ende, nichts als eine Sache der Ausstattung, Baum für Baum und Bild für Bild. Akribische Mühe haben alle Beteiligten - vom Wessi-Drehbuchautor bis zum Wessi-Regisseur - auf einen geradezu fetischistischen Umgang mit Marken verwandt, von Spreewald-Gurken bis zur Aktuellen Kamera. Aus der offensichtlichen Angst heraus, etwas könne nicht stimmen, stimmt nun vermutlich (wenn interessiert das aber?) alles im Detail – und doch ist der Effekt der eines umgekehrten Pointillismus. Punkt für Punkt hat man die Wirklichkeit abgemalt, das Gesamtbild, das entsteht, ist jedoch ein einziges lächerliches DDR-Klischee. Wolfgang Becker aber, ein Regisseur, der bisher nie enttäuscht hat, verschenkt all das an eine halbherzige Komödie mit melancholischer Grundierung und melodramatischen Familienverwicklungen, die außer einem erzählerischen Nebenstrang dem ganzen nichts hinzufügen. Mit der nachholenden Wut dessen, der nur die Zeichen kennt und nicht die Wirklichkeit, setzen Drehbuch und Regie auf höchst oberflächliche Wiedererkennbarkeiten, darin erschöpft sich ein großer Teil des Witzes. Nirgends hat man den Eindruck, dass die Klischeehaftigkeit des DDR-Bilds hier eine bewusste Sache ist, also Reflexion aufs eigene Treiben. Der Film glaubt durchaus an das, was er zeigt, gerade in den im schlechtesten Sinne fantastischen Umkehrungen, die er am Ende vornimmt. Komik entsteht aus dem Kontakt mit der Wirklichkeit, als deren Überzeichnung zur Wiedererkennbarkeit – oder durch Kontrastmomente, die in der Ausreizung des Unmöglichen die Begrenztheit des Wirklichen vorführen. „Goodbye, Lenin!“ dagegen sucht sein Heil in der Übertreibung von Klischees statt der Übertreibung der Wirklichkeit zum Klischee. Ein feiner Unterschied, mit dem die Komik des ganzen aber steht und fällt – im übrigen auch die Differenz zu Leander Haußmanns sehr viel gelungenerem Film „Sonnenalle“. Die Folge ist: dieser ganze nurmehr virtuell existierende Sozialismus hängt in der Luft, ist Anlass zu Scherzen, die ihn sich zurechtbiegen, wie sie ihn brauchen. Das Buch denkt immer nur vom Plot her, nie von den Figuren. Wenn ein Experte zur filmischen Wiederherstellung des DDR-Fernsehens gebraucht wird, schreibt man ihn ins Drehbuch: lebendig wird er dadurch nicht. Etwas Liebe braucht es auch - voilà, hier ist die russische Lernschwester Lara (Chulpan Khamatova), in die sich der Held vergucken kann. So geht das ohne Ende und nichts und niemand muss einen hier wirklich interessieren. Es kommt hinzu, dass „Goodbye, Lenin!“ – von einem einzigen Bild abgesehen, dem Titel-Bild, wenn man so will: einer per Hubschrauber abtransportierten riesigen Lenin-Büste mit zum Gruß erhobenem Arm – von enttäuschender inszenatorischer Einfallslosigkeit ist. Ein Fernsehfilm, aber kein guter. Im Wettbewerb der Berlinale leider völlig deplatziert. ... Link Sonntag, 9. Februar 2003
Solaris (Steven Soderbergh, USA 2002)
knoerer
13:07h
„Solaris“, der Roman von Stanislaw Lem, die erste Verfilmung von Andrej Tarkowskij und nun auch Steven Soderberghs Version, ist philosophische Science-Fiction. Das Interesse gilt nicht der Zuukunft, nicht den Möglichkeiten des technischen oder gesellschaftlichen Fort- oder Rückschritts. „Solaris“ ist weder Utopie noch Dystopie – nein, es geht darin allein um ein Gedankenspiel, für dessen Inszenierung die Kulisse der Science-Fiction benutzt wird. Und Soderbergh tut kaum mehr als das nötigste, um diese Kulisse einzurichten, wie hingetupfte Zeichen funktionieren der ferne Planet, die Hilfsmission, die Raumstation. Der Psychologe Chris Kelvin (George Clooney), so zunächst der reine Plot, wird per Videobotschaft zu Hilfe gerufen. Ein Raumschiff, das in der Umlaufbahn des Planeten Solaris liegt, ist in Schwierigkeiten geraten, welcher Art sie sind, erfahren wir zunächst nicht. Nicht mehr als einige statische Einstellungen, sehr bewusst Kubricks „2001“ zitierend, des schwerelos treibenden Raumschiffs, der Raumstation vor dem von rötlich-lila-gelben Lichtstreifen umgürteten Planeten. Dann ist Kelvin an Bord. Dort sind die Farben bleich, auf der Tonspur keine Musik zunächst, sondern die bedrohlich rauschenden, brummenden Eigengeräusche der Station. Kelvin stößt auf Spuren von Blut, trifft im Kühlraum auf Leichen – darunter die von Gibarian (Ulrich Tukur), des Mannes, der ihn zu Hilfe gerufen hatte. Auf zwei Überlebende stößt Kelvin, ihr Verhalten ist merkwürdig, in Andeutungen sprechen sie von dem Geheimnis, das hinter den seltsamen Vorgängen im Innere der Raumstation lauert. Kelvin legt sich schlafen. Soderberghs Kamera (wie fast stets ist Soderbergh, unter Pseudonym, sein eigener Kameramann) wählt einen eigenartigen verkanteten Winkel zum Blick auf Kelvins Kopf und seinen Oberkörper; in dieser fast unscheinbaren Einstellung liegt die ganze Intelligenz und Präzision des Regisseurs Soderbergh. Ins Bild gesetzt wird ein Charakter, dessen Welt aus den Fugen geraten wird. Es ist, als entspränge der schrägen Perspektive alles Folgende. Im Schlaf und doch nicht im Schlaf, in einem Zwischenreich, das evoziert, nie aber definiert wird, erscheint Kelvin seine Frau Rheya (Natasha McElhone), die vor Jahren durch einen Selbstmord ums Leben gekommen ist. Plötzlich, unerklärlich, aus dem Nichts ist sie da – keine Vision, kein Traum, sondern fassbare, greifbare Realität. Kelvin reagiert panisch, lockt den Geist, für den er die Erscheinung zunächst hält, in den Schleusenraum und stößt ihn hinaus in die Weiten des Alls. Rheya jedoch kehrt wieder, mit der Insistenz eines Gespensts. Mit der Insistenz auch einer Sehnsucht, von der man nicht lassen kann. Und als Verkörperung der Unfähigkeit, Abschied zu nehmen vom Menschen, den man geliebt hat (eine Szene der Trauerarbeit nach Art der anonymen Alkoholiker gibt es ganz am Anfang zu sehen). Soderbergs „Solaris“ konzentriert sich fortan auf den fantastischen – oder phantasmagorischen – Zwischenraum dieser unerklärlichen Wiederkehr, des erneuten Miteinander mit dem Anschein einer zweiten Chance, das vielfach gefährdet ist: durch die Crew des Schiffs zum einen, Gordon, die Astronautin, besteht darauf, dass die „Besucher“ (deren Anwesenheit ist das Geheimnis von Kelvins Auftrag) getötet werden müssen. Die Gefährdung kommt aber auch aus dem Inneren dieser Wiederkehr. Rheya ist mehr als bloße Projektion Kelvins, ein eigenständiges Wesen, ein Mensch aber ist sie nicht. In meditativen Bildern, untermalt von hypnotischer, repetitiver, pulsierender Musik entfaltet Szenen einer Ehe. Rheya, auf der Suche nach sich selbst und ihrer Identität, erinnert sich an das Leben auf der Erde, das erste Kennenlernen, die junge Liebe zu Kelvin, aber auch Probleme des Zusammenlebens. Die Bilder dieser Erinnerung (in wärmeren Farben, Brauntönen) schneidet Soderbergh in ihre Gegenwart hinein. Es handelt sich, technisch gesehen, um Rückblenden, die aber weit mehr sind als das – und sich zugleich keineswegs eindeutig auf eine objektive Vergangenheit beziehen. Was man sieht sind Bilder einer Vergangenheit, die die ihre ist und auch nicht. In nichts anderem nämlich lebt Rheya als in Kelvins Erinnerungen an sie. Im nicht-linearen Schnitt, der unheimliche Dopplungen und Parallelisierungen von Vergangenem und Gegenwart herstellt, treibt „Solaris“ die Erinnerung an die Grenze ihrer Ununterscheidbarkeit von der bloßen Einbildung. In der fast unmerklichen Parallelmontage von Erinnerung und Wirklichkeit findet dieses Stilmittel, das Soderbergh schon in seinen letzten Filmen zum Markenzeichen entwickelt hat, seinen philosophischen Gehalt. Die Objektivität des Bilds löst sich auf. Und diese Auflösung setzt Soderbergh im Schnitt ins Bild. Das Psychodrama von „Solaris“ ist ein Drama der Gegenwart materialisierter Erinnerung, an der in jedem Moment alles falsch sein kann. Nur zu konsequent ist das Ende des Films. Hier nämlich löst sich noch der letzte Halt auf, die Wirklichkeit der Gegenwart des scheinbar objektiven Bildes. Diesseits dieser komplexen Sachverhalte ist Soderberghs „Solaris“ nicht zu haben. Jede nur psychologische Lektüre wird auf eine kalte und glatte Oberfläche stoßen, ohne deren mit technischen Mitteln erzeugte Faltung in den Blick zu bekommen. Es ist kein Wunder, dass Soderbergh bei den Dreharbeiten immer wieder Filme von Alain Resnais vorgeführt hat. Sein „Solaris“ ist „Letztes Jahr in Marienbad“ im Weltraum. Ein Film über das Trügen des Scheins der Filmbilder, nicht weniger. Ein philosophische Meditation über Liebe und den Verlust eines geliebten Menschen ebenso wie über das Medium Film. Auf der Pressekonferenz hatte ein Journalist nichts weiter zu sagen, als dass er „Solaris“ langweilig finde. George Clooney, der sich zuvor charmant, geistreich, witzig und verbindlich zeigte, war kurz davor auszurasten. „What a jerk“ (freundlich übersetzt: „Welch ein Idiot“), beschimpfte er den Mann – und meinte wohl auch die Reaktionen der weithin ähnlich gestimmten Filmkritik. „Solaris“ ist eine Herausforderung. Mal sehen, ob die Jury unter dem Vorsitz des Kino-Intellektuellen Atom Egoyan sie annehmen wird. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8770 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

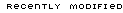
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||