
 |
... Vorige Seite
Dienstag, 14. Februar 2006
elementarteilchen
knoerer
15:41h
Kurzer Ausschnitt aus Libération zur Roehlerschen Houellebecq-Verwurstung. Nur so. Den Clayderman-Teil habe ich noch weggelassen. Tout dégouline : les acteurs ont franchi le degré acceptable de la nullité, le chef opérateur ne sait rien faire sans filtres verts, et Roeler (même génération que Houellebecq) n'a aucune idée de cinéma en tête. Grosse solitude du spectateur : endurer la vision misogyne et autodépressive de Houellebecq est déjà un boulot à mi-temps, mais ajoutez-y une mise en scène miteuse (et puritaine : ceux qui étaient venus dans l'espoir de se rincer l'oeil au camping échangiste sont repartis fumasses) et c'est l'effondrement. ... Link
Michael Winterbottom: The Road to Guantanamo (GB 2006, Wettbewerb)
knoerer
15:35h
Es gibt eine Szene in Michael Winterbottoms "The Road to Guantanamo", die erinnert an einen der schrecklichsten Momente in seinem Berlinale-Gewinner "In this World" von 2003. Die Protagonisten des Films landen in einem dunklen Container, menschenunwürdig zusammengepfercht, unterwegs zu einem sehr ungewissen Schicksal. Die Ähnlichkeit ist aber rein oberflächlich, denn die Machart der Filme ist denkbar verschieden. Der ältere Film zwang uns als Betrachter hinein ins Schicksal seiner Helden auf ihrem lebensgefährlichen Weg in den Westen; in einer filmischen al-fresco-Malerei erzählte Winterbottom eine Geschichte hautnah am Leben. Zwischen das geschilderte Schicksal, seine Bilder und unser Empfinden passte in den entscheidenden Momenten kein Blatt Papier und kein erklärendes Wort. Das Gegenteil ist der Fall im dieses Jahr im Wettbewerb laufenden "The Road to Guantanamo". Es mischen sich die Bilder und Stimmen in ganz anderer, und zwar missratener Art. Drei in Birmingham lebende Pakistanis berichten, als Talking Heads, was ihnen widerfuhr, als sie kurz nach dem 11. September 2001 in die Heimat reisten, die Grenze nach Afghanistan überquerten, in die Hände der US-Armee fielen und für mehr als zwei Jahre im Lager von Guantanamo Bay eingesperrt, gefoltert und wie Tiere behandelt wurden. Winterbottom verlässt sich aber nicht auf ihre eigenen Worte, sondern illustriert das, was sie zu sagen haben, mit den Bildern, die das Geschilderte in Spielfilmmanier, mit dräuender Musik dazu, nachstellen. Dies Verfahren der Illustration ist so primitiv, wie es klingt. Winterbottom unterbricht wechselweise die Illustration mit Erzählung, die Erzählung mit Illustration; es wird aber an keiner Stelle eine Reflexion daraus. Es kommen offizielle Nachrichtenbilder dazu, wir sind beim Geschehen dabei und blicken darauf, mittendrin und zugleich zum Urteil von draußen und hinterher fähig, so stellt Winterbottom, der bekanntlich schneller Filme dreht als andere Filmkritiken schreiben, sich das wohl vor. "The Road to Guantanamo" will also sehr viel auf einmal sein und ist deshalb eigentlich nichts richtig. Der Film versteht sich als durch die Aussagen der Beteiligten beglaubigte Dokumentation, als Pamphlet gegen den menschenunwürdigen Umgang der US-Amerikaner und Briten mit ihren Gefangenen, und im illustrativen Teil als Krücke für unsere Vorstellungskraft. Die Naivität, mit der Winterbottom die einfachen Mittel, mit denen er arbeitet, für tauglich hält, etwas anderes zu leisten als die Demonstration guten Willens und der politischen Korrektheit der eigenen Anschauung, ist beträchtlich. Oder, auch das wäre ja möglich, er will gar nichts weiter als das: Nur sagen und zeigen, ein Film als politische Intervention in eher fürs Fernsehen tauglicher Form. Es stellt sich nur, im einen Fall wie im anderen, die Frage, was sein Film im Wettbewerb eines Filmfestivals verloren hat. Andererseits: Er ist, was diese Frage angeht, in guter Gesellschaft. ... Link
Pen-ek Ratanaruang: Invisible Waves (Thailand 2006, Wettbewerb)
knoerer
12:03h
Das Verhängnis des asiatischen Kinos trägt den Namen Christopher Doyle. Der aus Australien stammende Kameramann ist nach erträglichen Anfängen als Handkamera-Experte inzwischen berühmt für seine schönen Bilder. "Schön" allerdings wie in "alles so schön grün hier" oder "warum nicht mit dem Kran über das Mäuerchen schwenken und die Figur kriegen wir auch noch unter im Bild"-schön. Oder "schön" wie in "dann noch eine Kamerafahrt hin zur Wand" oder "dann ist das Aquarium gut im Bild"-schön. Oder "schön" wie in "diese Fahrt durchs Dunkle kommt sicher sehr gut" oder "die Umrisse im Gegenlicht, das macht Effekt"-schön. Mit "2046" hat Doyle den einst interessanten Regisseur Wong Kar-wei dazu gebracht, einen unerträglich prätentiösen Film zu drehen. Was passiert, wenn er dann mit einem wie Pen-ek Ratanaruang zusammenarbeitet, der Der Plot, der Form halber, denn er interessiert hier keinen: Koji, der Koch ist und Killer und ein Japaner in Hongkong, tötet die Frau seines Chefs. Er macht mit dem Schiff eine Reise nach Thailand und begegnet dabei einer Frau mit einem Baby, die ihm am Ende als Freundin des Chefs, den er nun töten will, begegnen wird. Auf der Reise nach Thailand wird er von irgendjemandem verfolgt. In Phuket stirbt Koji, aber auch wieder nicht. Er kehrt zurück und es geht irgendwie aus, nur viel zu spät. Einer der letzten Sätze des Helden, übersetzt aus dem gebrochenen Englisch, das alle hier sprechen: "Es muss irgendwie enden, nicht wahr." Als hätte Selbstironie auch nur ein Machwerk der Filmgeschichte je retten können. Nichts zu sagen zu haben, das ist das eine. Das kommt vor. Sich aber in die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns zu verlieben, das, was ins Bild soll, möglichst hübsch zu drapieren einzig des dekorativen Effekts wegen, Dinge geschehen zu lassen, nur weil man sie irgendwie lustig findet, darunter Ambient-Musik zu legen und das was man sieht, in immerwährenden Schummer zu rücken, weil es dann schön "atmosphärisch" ist - all das erfüllt den Tatbestand des Unverzeihlichen. Christopher Doyles Kamera geht es niemals darum, eine Szene aufzulösen im Sinne der Herstellung einer Beziehung von Raum und Figur, im Sinne eines Interesses an möglichen Wirklichkeiten. Er will nur totgeborene "schöne" Bilder, in denen sich Vorder- und Hintergründe als Muster zueinander verhalten, nichts sonst. An die Stelle des Denkens in Bewegungs-Kadern tritt der Einfall, den man halt hat, der Schwenk, der nichts bedeutet. An die Stelle des filmischen Raums tritt das Unterwasserfarbige eines Bildkonzepts, das mit der Geschichte, den Figuren in rein beliebiger Verbindung steht. Kurz gesagt: Es gibt auf der Seite keines Beteiligten auch nur das mindeste Erkenntnisinteresse an der Wirklichkeit der Welt oder an Möglichkeiten des Films. "Invisible Waves" ist deshalb nicht nur geradezu betäubend langweilig, es handelt sich hier schlicht um Kino in seiner verabscheuungswürdigsten Form. ... Link
Chantal Akerman: Là-bas (Belgien 2006, Forum)
knoerer
08:07h
Chantal Akerman ist in Tel Aviv und führt dort eine Art filmisches Tagebuch hinter heruntergelassenen Rollos. Wir sehen durch die Ritzen das Geschehen auf Balkonen und Terrassen der gegenüberliegenden Häuser, nur ist dies Geschehen ohne Belang. Es tut sich wenig, minutenlang blickt die Kamera in starren Einstellungen hinaus auf ein Nichts an Veränderung. Es wird einem die Zeit auf die Dauer sehr lang, wenn man das sieht. Vielleicht wurde auch Chantal Akerman die Zeit sehr lang im von einer Bekannten gemieteten Appartment. Fragt sich nur: Was geht mich das an? Zwischen den Blicken auf die Häuser – die Einstellungen wechseln, einen großen Unterschied macht es nicht – gibt es kurze Telefonmonologe der Regisseurin in englischer, französischer und hebräischer Sprache. Und sie erzählt uns allerlei, das meiste von keiner Bedeutung. Dass sie das Brot aus dem Tiefkühlfach aufgetaut hat. Dass es ihr nicht so gut geht. Wiederkehrendes Thema ist der Selbstmord ihrer Tante Ruth, der Selbstmord der Mutter des Schriftstellers Amos Oz, den alle ihre Freunde lesen, manche aber kritisch. Ein paar Mal gibt es, kurz, Impressionen vom Meer, Impressionen vom Himmel. Später eine wildes Schnitt- und Schwenkpotpourri, das womöglich der filmische Ausdruck einer inneren Verwirrung der Regisseurin ist. Man weiß es nicht, es ist auch egal. Was sich einstellt, im Lauf dieser von kaum einem auch nur halbwegs interessanten Moment getrübten knapp 80 Minuten, ist der Eindruck eines phänomenalen Narzissmus. Warum glaubt Chantal Akerman, irgendjemand könnte den Wunsch haben, zu erfahren, was sie hier tut? Und wer hat ihr erzählt, sie könne Englisch? Es hat eine Weile gedauert, bis mir klar wurde, dass "de odeurs" the others sind. Immerhin ein Aha-Effekt in einem sonst nervtötenden Film. ... Link
hinweis: Henner Winckler: Lucy (D 2006, Forum)
knoerer
07:43h
Kurzer Hinweis auf einen Text zu Henner Wincklers schönem Film "Lucy" in der taz. ... Link
James McTeigue: V for Vendetta (USA 2006, Wettbewerb außer Konkurrenz)
knoerer
07:39h
Es ist eine Schande, drum gestehe ich's gleich: Ich habe den dem Film zugrundeliegenden Comic-Roman nicht gelesen. In Kenntnis anderer Werke von Alan Moore bin ich von der grundsätzlichen Unverfilmbarkeit seiner Comics allerdings überzeugt: zu beziehungsreich und anspielungsselig, zu literarisch und zu monomanisch ins Material gewühlt sind seine Sachen, oft genug Fußnoten und Appendices inklusive. Und "V wie Vendetta", als Film genommen, nicht als Verfilmung, macht innerhalb gewisser Grenzen Spaß. Moores Fabel vom in totalitärer Zukunft Britanniens das Regime, mit Hilfe und als genialer Manipulator des Volkes, umstürzenden Mann in Guy-Fawkes-Maske hatte ihre Zeit und ihren Ort und ihren Grund: das Thatcher-Regime, dem Moore in grimmigem Hass verbunden war. Ohne diesen Kontext, um Verschiebung in Gegenwärtiges halbherzig und kaum überzeugend bemüht, hängt diese ganze Geschichte nun mit beträchtlicher Irrelevanz in der Luft. Es schimmert der Reichtum Moorescher Ideen dennoch durch. Vor allem in der Ambivalenz des Helden, der als Demagoge von Gnaden vorzustellen ist, wenn auch die Wirksamkeit seiner Wirkungen aus dem, was der Film – in Auszügen aus dem Masterplan, wenn ich recht verstehe – hier zeigt, nur bedingt erhellt. Dass es dazu kommt, dass das Volk sich erhebt, geht aus den strategischen Zügen nicht wirklich zwingend hervor. Dennoch ist der Film als Übung in grimmiger Totalitarismuskritik zwar rundum ein wenig gratis, aber doch von bei Großproduktionen dieser Art längst nicht mehr üblicher Intelligenz. Die Brüder Wachowski, an deren Verstand zu zweifeln doch einiger Anlass bestand, zeigen sich hier mancher Überdeutlichkeit zum Trotz als ordentliche Drehbuch-Handwerker; James McTeigues Regie ist funktional und durchaus angenehm im Herstellen eines gewissen Intimismus und im weitgehenden Verzicht aufs Spektakel. Es wird daraus keine runde Sache, aber vielleicht ist das auch eine Form von Treue zu Moores graphic novel: Man ahnt, dass dem sehr viel Ausgefeilteres zugrundeliegt und man hat das Gefühl, dass diese Ahnung ausdrücklich zugelassen wird. Der Film, so scheint es, eilt, auf Wesentliches plus Action konzentriert, durch Moores ausuferndes Gedanken-Gebäude und öffnet hier eine Tür und dort auch. Die meisten bleiben zu, aber der Eindruck, sie seien vorhanden, vermittelt sich. [Der Hinweis auf Thomas Grohs wesentlich harschere Einschätzung des Films als Verfilmung.] ... Link Montag, 13. Februar 2006
Rodrigo Moreno: El Custodio (Argentinien 2006)
knoerer
15:51h
Mit einem Bildausschnitt beginnt der Film: Wir sehen, durch den Spalt einer Tür zwischen Schwarz und Schwarz auf der Leinwand, einen Mann, der sich wäscht. Er macht sich, das sehen wir weiter, bereit für den Einsatz. Er ist, wir sehen das weiter, Ausschnitt um Ausschnitt, der Leibwächter eines hochrgangigen Politikers. Wir erfahren, was wir erfahren, über den Mann der bewacht wie über den bewachten Mann, noch manches, aber immer nur, und immer nur sehr gezielt: im Ausschnitt. Der Leibwächter hat eine Schwester, die hat eine Tochter und die kann nicht singen. Der Politiker hat eine Geliebte und eine Tochter, die einem Freund im Auto unter der Beobachtung des Leibwächters einen runterholt. Es lässt sich vermuten: Sie spielt mit ihm, mit seinem Blick, seinem Begehren, das sich für die Funktion, die er bekleidet, nicht gehört. Auch der Politiker selbst verfügt über den Mann, der ihn bewacht, nach Belieben. Mit dem trockenen Witz, den er – gelegentlich – besitzt, kommentiert der Film diese Rolle als Mädchen für alles in der Familie in einem sehr präzise gewählten Ausschnitts-Bild. Wir sehen durch eine Tür einen Teil der Küche und hören, wie die Frau des Politikers den Befehl gibt, ein Kleid zu bügeln. Es ist nicht klar, wen sie adressiert, man sieht nur sie, den Leibwächter und das Kleid, erst nach einigen Sekunden Verzögerung kommt ein Dienstmädchen ins Bild. Man weiß nicht, worauf „El Custodio“ hinausläuft. Man weiß noch nicht einmal, ob er überhaupt auf irgendetwas hinausläuft. Die Spannung, die der Job nun mal nahelegt, bleibt derart latent, dass sie nur ganz gelegentlich spürbar wird. Wenn etwa das Funkgerät piept und keiner geht ran. Die Ausschnitthaftigkeit des Films ist so radikal, dass er einem keine eindeutigen Hinweise gibt, wie der Mann, der sein Titelheld ist, all das versteht. (Es wird, ganz zuletzt, eine Antwort geben, die hinreichend deutlich ist.) Mit einer Entschlossenheit, von der man nicht weiß, ob man sie noch atemberaubend finden soll oder nicht doch ziemlich enervierend, übt sich „El Custodio“ in Empathieverunmöglichung. Der Held dieses Films, der kaum spricht, der wenig tut, das ihn sympathisch macht, bleibt einem radikal fremd, Ausschnitt für Ausschnitt. Denn es ist keineswegs (eindeutig) seine Perspektive, die hier gewählt wird. Ja, wir wissen überhaupt nicht genau, von wo wir sehen, was wir hier sehen. Wir sehen den Ausschnitt, aber wir sehen und erfahren nicht, was uns vorenthalten bleibt. Wir folgen der Bewegung der Geschichte, aber wir wissen nicht, wohin sie sich bewegt. Wir sind, man muss es sagen, sehr allein gelassen von diesem Film, der doch Minute um Minute den Eindruck vermittelt, er wisse, was er tut. „El Custodio“ hat einen quasi-autistischen Helden. Er ist ein quasi-autistischer Film. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8762 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

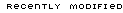
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||