
 |
... Vorige Seite
Montag, 13. Februar 2006
Matthias Glasner: Der freie Wille (D 2006, Wettbewerb)
knoerer
15:36h
Wie zeigt man eine Vergewaltigung? Wie einen Vergewaltiger? Matthias Glasner hat, sagt er in der Pressekonferenz, sechs Jahre über diese Frage nachgedacht. Er hatte ein Konzept zu Drehbeginn und dann habe er, am Drehort, die Kamera (er führte sie selbst) in der Hand, dieses Konzept über den Haufen geworfen. Was man nun sieht, ist natürlich zu viel und es ist kaum zu ertragen. Theo Stoer (Jürgen Vogel) fällt über ein Mädchen her und die Kamera nötigt uns durch ihr Dabeisein, dabei zu sein. Die Perspektive ist nicht die des Vergewaltigers, erst recht nicht die des Opfers, es ist die eines Zeugen, der nicht wegsehen kann. Matthias Glasner hat sich entschlossen, diese Geschichte zu erzählen, und zwar ohne Kompromiss. Es ist die Geschichte eines Mannes, der Unverzeihliches tut und nichts dringlicher wünscht, als es nie wieder zu tun. Er kommt nach neun Jahren frei, darf zurück in die Welt. Es ist, wie immer in solchen Fällen, eine Wette auf die Erlösbarkeit eines Täters, dem zu verzeihen man niemals geneigt ist. Und doch lernt man, indem man ihm folgt zurück in die Welt, mit ihm zu hoffen. Er lernt eine junge Frau kennen, die erst widerstrebt. Wir sehen sie mit seinen Augen erst, aber diese Perspektive wechselt. Zu den Zumutungen von „Der freie Wille“ gehört vor allem das: Wir sollen den Vergewaltiger sehen mit den Augen einer Liebenden. Und zu den Stärken des Films muss man zählen: Er manipuliert einen nicht, er verzichtet auf erschlichene Wirkungen, zum Beispiel durch den Einsatz von Musik. (Es gibt, an zentraler Stelle, Musik – aber dabei geht es nicht um Erschleichung von Gefühlen, sondern um das vom Geschehen zwischen den Figuren gedeckte Pathos einer Hoffnung.) Matthias Glasner hat seine Mittel für diesen Film weitestmöglich reduziert. Mit winzigem Team sucht er als Kameramann die Nähe zu den Darstellern. Auch sie suchen niemals den einfachen Weg. Niemals zuvor hat man Jürgen Vogel so zurückgenommen gesehen, so sehr gefangen in seinem Körper, so subtil in seinen Gesten. Sabine Timoteo als Netti, die Frau, die ihn liebt, versteht es, wie keine andere Schauspielerin im deutschen Film, das Gefühlte in huschenden Ausdrücken anzudeuten, ohne es auszuspielen. Ein Lächeln, das kurz auftaucht und wieder verschwindet. Und noch im Zusammenbruch spürt man keine Distanz zwischen einer Technik und dem, was sie zeigt. Obgleich Matthias Glasner in keine der Fallen, die bereit liegen, tappt – über die eine oder andere dramaturgische Entscheidung, über den Einsatz des einen oder anderen religiösen Motivs kann man streiten –, ist „Der freie Wille“ doch kein ganz großer Film. Es bleibt bis zuletzt das Gefühl eines Überschusses des Inhalts über die Form. Das Problem ist nicht, und kann nicht sein, dass er seine Erzählung nicht bändigt. Es ist vielmehr so, dass er die Mittel nicht findet, dem Ungebändigten, dem Unbändigbaren des Geschehens angemessenen Ausdruck zu verleihen. Oder, anders gesagt, es gelingt ihm nicht, für das Moment der Nicht-Erzählbarkeit einer solchen Geschichte Mittel zu finden, die das Konzept von Direktheit und Reduktion noch einmal reflektierend übersteigt. ... Link
Allan King: Memory For Max, Claire, Ida and Company (Kanada 2005)
knoerer
07:22h
Max ist ein schmaler Mann mit Stock. Mit Trippelschritten geht er im Gang auf und ab. Er singt viel, er liebt Claire, auch wenn beide vieles vergessen haben aus ihrem Leben, sie liebt ihn. An ihrem Geburtstag drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Einmal sehen wir Max noch im Gang, fast sieht er ein wenig aus wie der frühe Chaplin, die Füße gespreizt, ein kleiner Mann mit Stock, die Kamera blickt aus ein wenig Distanz. Wenig später erfahren wir: Max ist tot. Er ist gestürzt und am selben Tag noch im Krankenhaus gestorben. Seine Mitbewohner im Baycrest Seniorenheim werden in einer kleinen Runde versammelt, man erzählt ihnen von seinem Tod. Claire ist schwer getroffen, sie bricht in Tränen aus. Und doch wird sie es vergessen. Wieder und wieder wird man ihr vom Tod des geliebten Mannes erzählen, wieder und wieder wird sie es vergessen. Jedes Mal erneut erfährt sie den Schock, weint, trauert. Später erfahren wir, dass auch ihr Ehemann Max hieß. Sie verwechselt, scheint es, die beiden, sie erinnert sich an den einen Max und kaum an den anderen, oder sie sind zu einer Person verschmolzen. Den alten Leuten von Baycrest ist ihr Leben zerfallen, sie haben Alzheimer oder sind dement. Manche wissen es, manche ahnen es, oder manchmal ahnen sie es. Max, der viel sang, schien in seiner Ahnungslosigkeit glücklich. Eine scheint untröstlich, dann sagt sie, sie will nur noch sterben und später lacht sie und sagt, sie fühlt sich sehr jung. Allan King hat zuletzt in "Dying Grace" (2003), auch auf der Berlinale zu sehen, Todkranke in einer Palliativklinik beobachtet. Sterbende sind auch die Heldinnen und Helden in diesem Film. Halb ist ihnen mit der Erinnerung ihr eigenes Leben schon entglitten. Eine von ihnen, wird ihre Tochter sagen, die sie nicht mehr erkennt, ist nicht mehr die, die sie war. Sie war freundlich und intelligent. Jetzt tritt sie nach denen, die ihr helfen wollen. Eine andere sitzt auf dem Bett, auf dem Stuhl sitzt ihr sarkastischer Sohn, gemeinsam rekonstruieren sie Episoden ihres Lebens. Sie erinnert sich an lange Zurückliegendes, an anderes nicht. Ratlos sitzt man herum, denn das Ausgegrabene wird wieder verschwinden in einem Vergessen, das ganze Leben an sich reißt. Human ist "Memory for Max, Claire, Ida and Company" in seiner Unaufdringlichkeit. Der Film schweigt nicht davon, wie schwer erträglich das alles ist. Er hat eine Haltung zu dem, was man sieht; oft sieht man die Alten im Gespräch mit Beverly Zwaigen, einer Betreuerin. Die Kamera ist dabei, in der Nähe, sie versteckt sich nicht, sie hört zu. Manchmal reagieren die Gefilmten auf sie, ein paar dieser Szenen zeigt auch der Film. Mehr als Dabeisein ist seine Sache nicht. Musik gibt es nur zu Beginn und am Ende. Kein Voiceover-Kommentar. Der Film macht, dass wir ganz Auge und Ohr sind und Verbündete der Sterbenden, der großer Teile ihrer Leben Beraubten. Wir trauern mit ihnen um das, was sie waren. ... Link Sonntag, 12. Februar 2006
Robert Altman: A Prairie Home Companion (USA 2006, Wettbewerb außer Konkurrenz)
knoerer
15:32h
Fulminant beginnt der Film, führt einen Ich-Erzähler ein mit Namen Guy Noir (Kevin Kline), der in der Tat ein Privatdetektiv ist, nun aber beschäftigt als Sicherheitsmann bei der alten Live-Radioshow „A Prairie Home Companion“. Die Zeit ist, kaum zu glauben, die Gegenwart, die Veranstaltung natürlich ein Anachronismus, wie, im ganzen, doch auch der Film. Zauberhaft sind die ersten Bilder von Kameramann Ed Lachmann, edel die Farben und virtuos die Bewegungen zu Beginn. Wie Lachmann sich durch ein wahres Spiegelkabinett von Garderobe schlängelt und Dopplungen fängt auf allen Seiten, wie Altman seine Personen in Vorder- und Hintergründen inszeniert, das ist von hoher Virtuosität und ganz die alte Schule. Dann fährt die Kamera vom Unterbau des Theaters in einer Plansequenz auf die Bühne, dreht sich um ein paar der Figuren, blickt kurz ins Publikum, dann ein Schnitt und der Zauber ist dahin. Der Schwung ist weg und der Rest kaum einmal mehr als nur nett. Zwar organisiert Altman sein Personenensemble (mit Meryl Streep und Lily Tomlin, John C. Reilly und Tommy Lee Jones, Virginia Madsen und Woody Harrelson) mit der Souveränität, die ihm die Erfahrung verleiht. Der Schnitt wird aber zusehends kurzatmig, die Dialoge sind sehr viel weniger pointiert als zu Beginn und die arg vielen Musiknummern sind auf die Dauer ein bisschen ermüdend. Der Film ist ein autobiografisches Projekt seines Autors Garrison Keillor. Der stellt in „A Prairie Home Companion“ sich selber dar und seine gleichnamige Radioshow, mit der es, anders als im wirklichen Leben, zu Ende geht. Altman ist bekanntlich immer dann am besten, wenn er kalt und scharf und böse sein darf. Hier aber konfligieren offenkundig Interessen; denn auf seine um die eine oder andere Bösartigkeit nicht verlegene Art will Keillor mit seinem Drehbuch doch einen Abgesang als Hommage an sich selbst. Mit der Zärtlichkeit eines Rasiermessers fährt aber Altmans Blick über die zur letzten Show versammelte Gesellschaft. Man wartet, dass etwas passiert, aber er schneidet kein einziges Mal. In seinen besten Filmen ist es ein Glück, dass er zur Sentimentalität gänzlich unbegabt ist. Der „Prairie Home Companion“ gereicht es auf die Dauer zum Schaden. ... Link
Thomas Arslan: Aus der Ferne (D 2006, Forum)
knoerer
12:11h
Hinweis: Der folgende Text ist auf Englisch, weil für signandsight.com geschrieben. A true documentary film is a somewhat tautological affair: what you see is what you see, the way it is shown. Therein lies in the best of cases not a deficiency but a documentary's richness. It is and becomes and remains a matter, quite simply, of being there, with all the complexities this expression offers. And as this is, after all, a matter of showing not telling, it can and should go without much saying. Thomas Arslan's documentary "Aus der Ferne" is a marvelous one, as it gives something to see by offering directions to the viewer's gaze without ever giving prescriptions. What the camera registers, "Aus der Ferne", from afar and also so close, is given to us in order to be seen. Thomas Arslan belongs to a bunch of German directors - Angela Schanelec and Christian Petzold among them -, who have been grouped by critics under the label "Berlin school". What they have in common is an unusual level of aesthetic reflexion. It makes itself felt - as an absence of cliché and stupidity - in every single frame of this film that begins in Istanbul and moves to Turkey's most eastern parts. There is a signature image that turns up repeatedly, at every important step of this journey. It is a shot out of rooms with (sometimes not much of) a view. What is given in these shots is an open window and a view, but also the window's frame that is necessary for the "there" to come into cinematic being. A true documentary is a window to the world that never forgets that there is no picture without a frame and a framing device. The director's voice adds to these signature images by giving just the facts of the place and the narrator's position. Thomas Arslan was born in Turkey and went to elementary school in Istanbul. He came to Germany when his father left the country - to which Arslan had not returned for twenty years. That much we learn about him. Turkey is the country of his childhood and this might explain why he prefers to show children in this film. Children immersed in play and action, but also children at work and children reacting playfully to the camera's presence, thereby always making the camera's absence felt, the absence of that which makes you see what is there. Arslan's camera does not move much. It follows and presents the movement to the East by filming the roads traveled on this journey. And a few times it opens places and spaces in wonderful pans, giving a sense not simply of an openness to the "being there" of the world, but also of a documentary's power of making it visible - within the limits, of course, of the tautologically possible. ... Link
nur im fernsehen
knoerer
09:51h
Sehr schönen Satz noch gehört, beim Zappen gestern Abend vorm Einschlafen: "Unglaublich, ich bin Olympiasieger; ich hab immer gedacht, das gibts nur im Fernsehen." (Weiß gar nicht, welcher der beiden das war. Zu müde, das noch zu registrieren.) ... Link
Romuald Karmakar: Hamburger Lektionen (D 2006, Panorama)
knoerer
08:44h
Wir haben Manfred Zapatka nicht mit Heinrich Himmler verwechselt, wir verwechseln ihn nun auch nicht mit dem islamischen Prediger Fazazi. Aus Zapatkas Mund kommen fremde Worte, die er sich nicht aneignet. Er stellt sie nicht dar, er spricht sie nur aus. Die "Hamburger Lektionen" sind die Karmakarisierung – da es nun, beim zweiten Mal nach dem "Himmler-Projekt", Methode wird, ist die Wortprägung fällig – zweier Frage-und-Antwort-Veranstaltungen in der Hamburger Moschee, die drei der Attentäter vom 11. September besuchten. Ob sie bei diesen beiden Terminen im Jahr 2000 zugegen waren, werden die, die es wissen, keinem verraten. Fazazi, der hier den Koran auslegt, sitzt inzwischen im Gefängnis, in Marokko, des prägenden Einflusses auf andere Untaten wegen. Manfred Zapatka sitzt auf einem Stuhl, zwei Schemeltischchen neben sich, einer links, einer rechts. Der Hintergrund ist neutral, eine Wand wie im Museum, die nicht sich, sondern, das, was zu ihr kontrastiert, zur Geltung bringt. Vom Schemel linker Hand nimmt Zapatka den Text, den er liest, auf dem Schemel rechter Hand legt er ihn wieder ab. Drei oder vier unterschiedliche Einstellung kennt die Kamera, eine von halbrechts halbnah, zwei Frontale, eine davon ein Close-Up aufs Gesicht des Darstellers, der nichts darstellt außer dem Vorlesenden, der er ist. Nur wenige Male nimmt eine Einstellung das Gesamtarrangement in den Blick: den Mann auf seinem Stuhl, die Schemel, den Raum. Kaum Ablenkungsmanöver, nur gelegentlich wird ein Zettel reingereicht, nur gelegentlich fällt der Schatten des Körpers des Regisseurs (oder eines Helfers) auf die Wand hinter Zapatka. Volle Konzentration auf den Text. Der Prediger Fazazi widmet sich theologischen Fragen, in einiger, für den vielleicht nicht so am Detail Interessierten, doch etwas enervierender Ausführlichkeit. Verhandelt wird etwa der genau Termin des Beginns des Ramadan. Sorgfältig ist der vorgelesene Text dabei übersetzt, zwischendurch immer wieder unterbrochen durch Erläuterungen von Begriffen, die termini technici sind und auch im arabischen Original genannt werden. "Bidaa" etwa, was Reform heißt und als Abweichung vom Koran und der Sunna grundsätzlich von übel ist. Oder "halal", das heißt "erlaubt". In den, aus terrorismustheoretischer Sicht jedenfalls, interessantesten Passagen wird es darum gehen, ob es erlaubt ist, sich am Eigentum der Ungläubigen zu vergreifen. Ja, wird der Prediger sagen, es ist "halal", denn die Ungläubigen haben es den Muslims immer schon gestohlen. Da wird wenig verklausuliert. Weil man – auch immer schon – im Krieg ist mit den Ungläubigen, ist es auch erlaubt, sie zu töten, um nicht getötet zu werden. Wie Fazazi diesen Sprengstoff in theologische Haarspaltereien hineinfaltet und in rituell wiederkehrende Formen wickelt, das gibt einen guten Eindruck, denkt man, vom Denk- und Empfindungsmilieu des Fundamentalismus. Eingeblendet werden auch immer wieder die Reaktionen des in der Zapatka-Lektion natürlich nicht nachgestellten Publikums: lautes Lachen, unterdrücktes Kichern. Das Einverständnis zeigt sich so, nachvollziehbar, auch und erst recht im nicht Ausgesprochenen. Der Humor der Fundamentalisten ist die Freiheit zur Tötung des Andersdenkenden. ... Link
Michel Gondry: Science of Sleep (F 2006, Wettbewerb außer Konkurrenz)
knoerer
08:22h
Wir werden hineingeworfen in diesen Film, mitten in die ausufernde Fantasieproduktion seines Helden, der gerade ankommt. Michel Gondry ist übermütig genug, erst einmal nichts zu erklären, sondern seinen Film mit uns Sachen machen zu lassen, auf die der Reim sich erst später einstellt, wenn überhaupt. Die Überrumpelung beim Überschreiten der Grenze ist sein Prinzip. Die Grenze, um die es geht, ist die zwischen Realität und Traum, zwischen Tagtraum und Brotjob. Stephane taumelt hin und her, erfindet im Traum ein wahres Leben, das im richtigen Leben das falsche ist, aber nicht ganz. Denn er trifft auf Stephanie, seine Nachbarin hinter der Tür gegenüber. Erst rollt und purzelt das Klavier die Treppe hinunter, dann irgendwann versteht man, dass dadurch zwei fürs Leben Verstimmte einander finden. "Science of Sleep" entscheidet sich nicht: für die reine Komödie, fürs reine Drama. Er hält, polternd, purzelnd, jäh hin und her schwingend eine eigenartige Form von Balance in steter Bewegung. Die Traumwelten sehen aus wie eines der wunderbaren Musikvideos von Michel Gondry. Alles selber gebastelt, aus Filz und Stoff und Pappe. Die Welt wird neu erfunden, als modellierbar. Weder Räume noch Dinge haben die Stabilität, die wir von ihnen zu erwarten gewohnt sind. Manches erinnert zunächst an den Künstler Thomas Demand, der für seine Fotos Alltagsszenarien, Zimmer, Büros und so weiter aus Pappe nachbaut. Im Foto sehen sie hinterher täuschend echt aus. Gondry will von seinen Pappwelten nachgerade das Gegenteil: den Do-it-yourself-Aspekt, das Gebastelte und Verhaspelte. Mitunter gefällt sich ein Einfall zu lange in der eigenen Bizarrerie, dann aber geht es, hektisch und verliebt in die Miniatur, ins Spiel um des Spiels willen, weiter. Natürlich denkt man an Gondrys letzten Film, das Charlie-Kaufman-Vehikel "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", aber "Science of Sleep" fühlt sich fundamental anders an; als hätte man aus dem Vorgängerfilm sämtliches dramaturgische Gestänge herausgenommen. Der neue Film ist ein Weichtier, ein flinker, sprunghafter, zu allem bereiter Mollusk aus Pappmache und Filz. Auch ein Gegenentwurf. Die Story kommt, so viel steht fest, kaum vom Fleck. Als wär's ein Traum, in dem man rennt und rennt und doch geht's fast nicht voran. Die pathologischen Aspekte der Tagträumerei leugnet der Film, je länger er dauert, keineswegs. Er schlägt sich trotzdem nicht auf die Seite eines objektiven Außenblicks. Er ist der Lust am Fallen aus dem Realen selbst zu sehr verhaftet, eine wunderbare kleine Traummanufaktur. Großartig ist das Spiel der beiden Hauptdarsteller, Gabriel Garcia Bernal und Charlotte Gainsbourg. Er ist ganz Überschwang und rasende Betriebsamkeit, einer, der dilettantisch, aber doch mit Bravado, ein paar Bälle zu viel auf einmal jongliert. Linkisch dann auch, verloren zwischen den Welten, gegen Türen rennend, die geschlossen sind und geschlossen bleiben. Gainsbourg als sein Widerpart Stephanie verkörpert mit sehr viel mehr Ruhe eine Art Korrektiv, wenngleich keineswegs das Realitätsprinzip per se. Sie sind zuletzt, im Leben als Traum, im Traum als Leben, füreinander geschaffen. Da bringt die Zeitmaschine, die Stephane erfunden hat, schon die Wahrheit ans Licht. (Wollen wir wenigstens hoffen.) ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8762 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

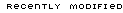
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||