
 |
... Vorige Seite
Samstag, 11. Februar 2006
Oskar Röhler: Elementarteilchen (D 2006, Wettbewerb)
knoerer
15:22h
Wenn an Michel Houellebecqs "Elementarteilchen" überhaupt etwas interessant ist, dann die Wurschtigkeit, mit der er die Romanform Romanform sein lässt und einfach seinen zu gleichen Teilen kindischen wie reaktionären Geschlechter- bzw. Geschlechtlichkeits-Philosophie-Sums cum Klonvision in unvermittelter Abwechslung mit pornografischen Höhe- und Tiefpunkten auf die Seiten schüttet, ein wenig Kabarett drüberstreut (chinesisch-deutsche Bedienungsanleitungen, sic!) und zwischen den ganzen Schrott Figuren setzt mit Biografien, ohne doch im Ernst an ihre psychologische Schlüssigkeit zu glauben. Manchmal legt er ihnen seine Traktate einfach so in den Mund und manchmal spricht auch irgendwer (sagen wir: der Erzähler) und tut SPIEGEL-Titelgeschichtenweisheiten kund. Zu einer solchen Gleichgültigkeit der Tradition abendländischen Erzählens gegenüber gehört immerhin Chuzpe. Es ist unter diesen Voraussetzungen das Gegenteil einer guten Idee, das alles für die Verfilmung erst mal in der Form radikal zu konventionalisieren. Also eine Geschichte daraus zu machen mit einer Entwicklung und mit Figuren, die auf ihre Zusammenhängigkeit hin durchsichtig werden sollen. Daran müssten auch bessere Darsteller als Moritz Bleibtreu oder Christian Ulmen gnadenlos scheitern. Und, oh wie sie scheitern! Und, oh wie erbärmlich dieser Film ist! Nicht die Spur eines Gedankens für die eventuelle Möglichkeit einer Form, in der diese Figuren und diese Geschichte irgendwas machen. Muss ja nicht gleich Sinn sein. Der "Ort der Wandlung", schon im Roman der Anlass zu denkbar dumpfer Satire, ist nun reiner deutscher 90er-Jahre-Filmkomödien-Horror, die chinesisch-deutsche Bedienungsanleitung hat selbstverständlich auch ihren Auftritt. Verlegt haben Oskar Röhler und sein Mittäter, der große Nivellator Bernd Eichinger, die Geschichte in die Gegenwart und nach Berlin. Merken tut man davon nichts, so luftleer und tot hat man filmischen Raum lange nicht mehr gesehen. Kaum zu glauben, wie brav alles gerät, wie sehr sich der Film auf der Suche nach einem großen Publikum alles Pornografische verkneift. Freilich gibt es eine Art ästhetischer Eindimensionalität und Buchstäblichkeit, die an Stumpfheit alles Pornografische übertrifft. Davon gibt es in Röhlers "Elementarteilchen" mehr als genug zu sehen. ... Link
Terrence Malick: The New World (USA 2005, Wettbewerb außer Konkurrenz)
knoerer
11:55h
Als "kolonialistischen Softporno" hat Klaus Theweleit "The New World" beschimpft. Dieses Urteil ist nicht einfach richtig oder falsch, es ist vielmehr der schärfstmögliche Widerspruch zu dem Projekt, um das es sich bei Malicks Film handelt. Dieses Projekt ist so simpel wie maßlos: die Darstellung der Unschuld, und zwar am Nullpunkt der amerikanischen Zivilisation, wie wir sie kennen, in der Begegnung der Ureinwohner mit den ersten Besiedlern. Es ist das Jahr 1607, aber im Grunde ein Jahr Null. Oder nicht die Darstellung, sondern die Herstellung, denn das Projekt ist kein historisches - es nutzt nur die nahe liegende historische Gelegenheit -, sondern ein philosophisches. Und ein philosophisches eher als ein (film)ästhetisches, darin liegt eine entscheidende Krux der Unternehmung. Was Malick inszeniert ist eine tota allegoria der Unschuld der Welt an ihrem, oder jedenfalls: einem, über alles historisch Besondere eben aufs Grundsätzliche hinausweisenden Ursprung. "Tota allegoria" heißt nun, dass Malicks Film, "The New World", sich darstellt als geschlossenes Übertragungssystem von Bedeutungen, in dem nichts nur das meint, was es ist und alles, was man sieht, mehr meint als es ist. Der Wind in den Halmen, das Lächeln der Frau, deren Namenstaufe so lange aussteht, die Weißen, die Roten, das Huhn und die See: alles es selbst und noch mehr, die Unschuld, die Liebe, Mutter Natur. Die Bedeutungen, die Malick allegorisch hineinträgt, wir sollen sie fühlen. Das versteht sich nicht von selbst und führt - sehr konsequent - zu einer bestimmten Form von Überwältigungsästhetik. Und die ist, was nur auf den ersten Blick überrascht, in schlichter Weise konventionell. Das betrifft vor allem James Horners Musik, die mit unablässiger Pasticheproduktion beschäftigt ist. Der Rahmen ist dabei eng gesteckt, von früher bis später Romantik, Chopin bis Bruckner und Wagner in etwa, letzteres für den Aufschwung ins Sakrale, der ein ums andere Mal nicht ausbleibt. Bezeichnend, dass er bis zu, grob gesagt, Mahler nicht mehr gelangt. Denn hier beginnt die Zitathaftigkeit, die Möglichkeit einer Übernahme, die einklammert und in Frage stellt statt einfach nur hinauszuweisen ins Gefühlte einer anderen Welt. Die Überwältigung zur Unschuld, auf die Malick hinauswill, ist teuer erkauft. Mit dem Verzicht auf Witz und Ironie, auf Reflexion und Bewusstsein von Form und ästhetischer Tradition. "The New World" reicht über die Formensprache Hollywoods keineswegs hinaus. Unschuld, als in konventioneller Herstellung behauptete, ist mitunter so fad wie der Puritanismus, der mit ihr hier einhergeht. Denn irgendwann gibt es zwar ein Kind, aber Sex hatten die Eltern im Bild jedenfalls nicht. Und dennoch: Es bleibt für den, der es mag, die Möglichkeit, der Überwältigung sich nicht gänzlich zu entziehen. So teuer die Unschuld erkauft sein mag, in den Grenzen, die Malick ihr zieht, hat sie ihre vom Kitsch schlichter Machart im großen und ganzen doch unterscheidbaren Reize. Der Mut und die ja fraglos sehr bewusste Entschlossenheit, mit dem hier den Theweleits dieser Welt die nackte Schulter gezeigt wird, verdienen einen gewissen Respekt. Und doch wird man denen, die glauben, das Paradies, falls das Kino es herstellen kann, müsse so aussehen wie "The New World" nun aussieht, widersprechen. Jean-Luc Godard hat seinen letzten Film "Notre Musique" als Triptychon gestaltet, mit Darstellung des Paradieses am Schluss. Dies Paradies, als Vision, ist ohne die Hölle der Kriege, die Hölle des Wissens, das wir haben von den Verbrechen der Menschheit, so Godards These, nicht zu haben. Das Paradies bei Godard ist ein Ausblick wider besseres Wissen. Aus dieser Perspektive ist Malicks Unschuld einfach falsch. Das Auge des Betrachters kann und darf den Kolonialismus so wenig vergessen wie den nahe liegenden Sexismus des Kamerablicks. Dies Vergessen wäre dann die Reinform ästhetischer Ideologie. Und "The New World" nichts weiter als ein kolonialistischer Softporno. ... Link
Lukas Moodysson: Container (Schweden 2006)
knoerer
07:52h
Der schwedische Regisseur Lukas Moodysson hat sich mit seinen ersten beiden Filmen "Fucking Amal" und "Zusammen" beim internationalen Publikum beliebt gemacht. Seither aber nimmt er sich die erstaunlichsten Lizenzen, es zu schockieren und zu vergraulen. Sein letzter Film "A Hole in the Heart" brachte einen Amateur-Porno-Dreh auf die Leinwand. Und "Container", nun in der Panorama-Reihe zu sehen, ist auf jeden Fall eines: eine beträchtliche Zumutung. Schlicht, schwarz-weiß, mit sehr nüchternen Schrifttafeln beginnt es. Und dann stürzt einen der Film in eine schreckliche Welt. Sie ist von Anfang bis Ende dissoziiert, in eine Tonspur und eine Bildspur, beides hat miteinander zu tun, aber zunächst nicht in eindeutig geklärter Weise. Auf der Tonspur zu hören ist die Stimme einer Frau, die in amerikanischem Englisch und in monotonem Singsang den auralen Stream-of-Consciousness liefert zu den extrem körnigen Bildern, die aussehen wie mit einer 8-mm-Kamera gedreht. Ein dicker Mann bewegt sich durch eine vermüllte Wohnung. Die Stimme der Frau auf der Tonspur ist das Ich zu diesem Mann, der sich für eine wunderschöne Frau, ja, einer Schauspielerin in einem hässlichen Körper hält, von aller Welt begehrt, von Paparazzi verfolgt. Klatsch-Nachrichten von Paris Hilton bis Brad Pitt bis Kylie Minogue werden in den unablässig im selben Ton vor sich hin nölenden Singsang eingespeist. Das Ich, das hier spricht, ist krank, es jammert, es beklagt das Elend der Welt. Zu seinen Obsessionen gehören auch Katastrophen, der Weltkrieg, Tschernobyl, das Ende der Welt. Währenddessen sind Bilder von Müllhalden zu sehen, der dicke Mann verklebt sich mit Tesa das Gesicht, bindet sich eine kleine Plastikpuppe vor den Mund. Eine Frau kommt, im Bild, ins Spiel. Der dicke Mann trägt sie, sie ist, das scheint recht klar, die Frau in seinem Innern, nach außen projiziert. In einem fort fluten die Bilder, der Müll, der Mann, die Frau, in einem fort fluten die Worte, die Katastrophen, das Elend der Welt. In den besten Momenten bekommt das etwas Hypnotisches, in den schlechteren versteht man den nicht unbeträchtlichen Teil des Publikums ganz gut, der das Weite sucht. Lukas Moodysson, ein kleiner Mann mit Schal und Hut in Schwarz, flammend gelbe Intarsien in den gleichfalls schwarzen Schuhen, trägt im Q&A hinterher zur Aufklärung über das, was man da eben gesehen hat, nicht gerade Sachdienliches bei. Wie der Text entstanden ist, kann er eigentlich nicht genau sagen. Die beiden Darsteller, die neben ihm stehen, versichern, den Film zum ersten Mal gesehen zu haben. Sie stehen offenkundig unter Schock. Das ist, sagt die Frau, die eigentlich Tänzerin ist und das imaginierte Schauspielerinnen-Star-Ich im Innern des dicken Mannes darstellt, das ist nicht das Drehbuch, das ich gelesen habe. Falls Moodysson mit seinem Film allgemeine Ratlosigkeit erzeugen wollte: Es ist ihm gelungen. ... Link Freitag, 10. Februar 2006
Michael Glawogger: Slumming (Österreich 2006, Wettbewerb)
knoerer
19:26h
Michael Glawoggers Film “Slumming” ist außen hart und innen ganz weich, mit gar nicht wenig Humor zwischendrin. Vier mögliche Gründe also, ihn nicht zu mögen, der Härte wegen oder des Zarten, des Humors oder der Mischung des Unverträglichen. Wollte man ihm böse sein, er wäre wohl schutzlos wie ein Rehkitz auf den verschneiten Straßen Wiens. Ich mochte ihn gern, auch deshalb. Auf die im ganzen realistische, von Surrealem leise durchzogene Welt dieses Films losgelassen wird der Trinker Kallmann (furios, aber mit Disziplin: Paulus Manker), „Fahrscheine bitte“, „in Oarsch eini bitte“, pöbelt er sich durch die U-Bahn und die Mariahilfer Straße hinauf in Wien. Er ist ein Dichter, ein herunter- und wahrscheinlich sowieso nie hinaufgekommener, er trinkt und ist betrunken, schimpft, schnorrt, stiehlt, tut nichts Gutes, bzw. für ein Bier oder einen Schnaps einfach alles. Auf die Welt losgelassen auch Sebastian aus Berlin (nicht ohne diabolische Züge: August Diehl), ein Junge aus reichem Haus, der tut, wonach ihm der Sinn steht und der so mit grausamer Gleichgültigkeit Taten verübt, die aus der Welt keinen besseren Ort machen. Er trifft Frauen, die er beim Chatten kennenlernt und fotografiert unterm Tisch unterm Rock ihre Höschen. Pia ist eine der Frauen, eine Volksschullehrerin, an der er hängen bleibt, weiß der Teufel warum. Sein Spießgeselle heißt Alex (Michael Ostrowski), gemeinsam unternehmen sie Streifzüge durch die Wiener Unterwelt und nennen, diese Art, Welten kennezulernen, in die sie nicht gehören, wie der Titel schon sagt „Slumming“. Das jüngere österreichische Kino treibt gern Spielchen mit dem Zufall (man denke an Barbara Albert, die hier dramaturgisch beraten hat, und ihre „Bösen Zellen“) – und also will es der Zufall, dass sich der Trinker und die Slummer begegnen, eines Nachts. Sebastian und Alex machen sich einen Spaß und verfrachten den vom Rum Gefällten über die Grenze in einen kleinen Ort in Tschechien. Da wacht er dann auf am nächsten Morgen und fragt sich und die Welt: „Was ist hier los?“ Diese Tat, die eine Untat ist, wird erstaunliche Folgen haben. Kallmann wird Bambi begegnen im Wald und den sieben (oder so) Zwergen im Eis, denn nun nimmt eine Art Märchen (und jedenfalls das Zarte im Film) seinen Lauf. Oder ein Wunder. Da hat einer, der eher Böses wollte, Gutes geschaffen. Ansichtssache vielleicht, denn nun schaufelt Kallmann nüchtern Schnee für ein bisschen Geld. Sebastian macht sich davon, Slumming nun in richtigen, indonesischen Slums, ein wenig wie sein Schöpfer Michael Glawogger, der für seine Dokumentarfilme, „Workingman’s Death“ zuletzt, auch immer in die Welt hinaus geht. Glawogger bringt regelmäßig arg schöne Bilder von schrecklichen Verhältnissen mit. Sebastian wird eventuell nur bekehrt. Ein besserer Mensch. Daran glaubt der Film mit gewisser Arglosigkeit schon. Es will mir nur nicht so recht gelingen, es ihm übelzunehmen. ... Link
wettbewerb
knoerer
15:07h
Der Besuch der Wettbewerbsfilm-Pressevorführungen lohnt oft der Dummheit wegen, auf die man im Publikum, in der vulgo Weltpresse also, trifft. Heute morgen reden zwei Typen hinter mir Blech. Mann, redet ihr ein Blech, denke ich mir. Dann beginnen sie auf die taz zu schimpfen. Sie sind beleidigt, dass "Snow Cake" nicht gut wegkommt. Er hat mich doch emotional berührt, sagt der eine trotzig. Das ist doch gut, wenn einen ein Film emotional berührt. Ich lese die taz ja nur noch während der Berlinale, sagt der andere. Und dann besprechen sie dieses obskure Zeug. Meint er wohl den Benning-Film. Möchte ja wetten, dass den beiden die unsägliche Dänen-Soap gefallen hat. ... Link
Amos Gitai: News From House / News From Home (Israel 2006, Forum)
knoerer
14:46h
Filme sind auch Erfahrungen, die man macht, wenn man sie sieht. Manche Filme bleiben fad von Anfang bis Ende. Manche packen dich und lassen dich nicht mehr los. Andere bauen ab oder hängen durch. Amos Gitais „News From House / News From Home“ fand ich erst so langweilig, dass ich nach zehn Minuten raus wollte, um vielleicht doch lieber George Clooney in „Syriana“ zu sehen. Ich blieb. Der Film wurde halbwegs interessant. Dann verblüffend. Dann umwerfend. Dann war ich den Tränen nah. „News From House / News From Home“ ist ein Dokumentarfilm. Der sehr renommierte israelische Regisseur Amos Gitai, ein gelernter Architekt, besucht einen eigenen Film, zwei Filme sogar, genauer gesagt. Der erste entstand im Jahr 1979, der zweite vor neun Jahren. Stets ging es um ein Haus in Jerusalem, das bis 1948 einer palästinensischen Familie gehörte. Seither leben Israelis darin. Vor 27 Jahren wurde daran gebaut, heute wird weitergebaut. Vor neun Jahren besuchte Gitai die Familie Dajani, die seit 700 Jahren in Jerusalem lebt, der einst das Haus gehörte. Für seinen neuen Film besucht er sie ein weiteres Mal, viel hat sich nicht verändert. Ratlos saßen sie auf der Couch, ratlos öffnen sie ihm heute die Türen. Später wird Gitai Dr. Dajani begleiten auf die Straße vor dem Haus, das ihm lange nicht mehr gehört. Dann sucht Gitai eine Verwandte der Dajanis auf, sie lebt in Amman, Jordanien, ist nach 1948 nur zweimal nach Jerusalem zurückgekehrt. Sie ist eine formidable alte Dame von achtzig Jahren, hat sich ihr riesiges Haus zum orientalischen Salon staffiert, mit Teppichen an den Wänden, Blumen überall, Schmuck und Ornament, Plüsch und Fotos der Herrscherfamilie von Jordanien. Sie erzählt aus ihrem Leben, ist geistig präsent. Sie zeigt Fotos, wie fast alle, sie zeigen Amos Gitai Fotos, zu denen sie Geschichten erzählen, von Toten meist. Noch eindrucksvoller der Besuch bei der heutigen Bewohnerin des Hauses, das hier als zentrale Metapher fungiert, als Metapher des Verhältnisses von Palästinensern und Israelis. Sie ist in der Türkei geboren, erzählt von der Toleranz, die dort den Juden entgegengebracht wurde, vom friedlichen Zusammenleben von Moslems und Juden und Christen. Ihr Vater war ein Uhrmacher aus Deutschland, der die Uhren in den türkischen Moscheen reparierte. Sie findet es nicht gerecht, dass sie nun dies Haus besitzt, das einem anderen gehörte. „Es ist die Geschichte“, sagt sie. Ich habe sie nicht gemacht, ich kann sie nicht rückgängig machen. Beim Besuch bei einem der Nachbarn, Herrn Kichka, er wohnt gleich gegenüber, stockt einem der Atem. Ein Israeli, der von einem bronzenen Schlüssel erzählt, den ein Enkel des früheren Bewohners des Hauses bei einem Besuch sehen wollte. Der Schlüssel, erklärt Herr Kichka, ist das Symbol des Rückgabeanspruchs, bei den Palästinensern. „Damit erhalten sie erhalten den Anspruch auf ihr einstiges Eigentum aufrecht.“ Er erzählt von einer extremistischen palästinensischen Karikaturistin, deren Signatur einen Schlüssel beinhaltet. "Er ist im Computer, er ist immer schon im Bild." Es seien furchtbare Karikaturen, erzählt er, Sharon, der im Blut der Palästinenser badet. „Karikaturen“, insistiert er, „sind wichtig. Sie sagen uns, was die Leute denken.“ Dann zeigt er Fotos, auch er, schwarz-weiß, seine Großeltern, Großtante, alle von den Nazis ermordet. Amos Gitai rechtet nicht. Er lässt beide Seiten zu Wort kommen. Niemand eifert hier, alle wissen um das Ausmaß des Unglücks. Die meisten Szenen sind mit der Steadycam gefilmt – und das kommt einem bald vor wie eine subtile ästhetische Metapher. Keine Handkamera, keine Reißschwenks, kein Gefuchtel. Gitai will die Ruhe bewahren im Auge des Sturms. Er macht außerdem Sachen, die man bedenklich finden könnte. Seine Stimme meditiert im Voiceover aufdringlich über das Haus als Metapher, es klingt, als hätte man aus Versehen den verzichtbaren Audiokommentar einer DVD eingeschaltet. Irgendwann denkt man aber, es ist seine Stimme, die wichtig ist, sein Englisch mit dem recht starken Akzent, nicht das, was er sagt. Unter vielen Bildern liegt Musik, Klaviergeklimper. Auch das ist manchmal zuviel des Guten, aber andererseits ziemlich egal am Ende. Sublim ist der Schluss. Man sieht das Gesicht von Natalie Portman auf der Fahrt durch das Tal des Jordan. Mit ihr hat Gitai seinen letzten Spielfilm gedreht, „Free Zone“. Sie sagt nichts, sie hält nur die Augen offen, zeigt einmal hinaus in die vorbeifliegende Landschaft. Man weiß nicht, was sie da gesehen hat. ... Link
welt
knoerer
14:03h
Vorhin in der Schlange vor der Kasse in der Mall eine gute Bekannte getroffen, die da anstand. Sie erzählt mir, dass sie in Kambodscha war und Vietnam. Und dann, kurz danach, im Sudan. Sie erzählt dies und das, wie lästig die herzensgut gemeinte Gastfreundschaft der Familie im Sudan ihr irgendwann war. Hinterher erst fällt mir auf, dass mir das vorkam wie das Selbstverständlichste von der Welt. Festival-Vertigo. Gestern Teheran. Heute Jerusalem. Dazwischen die Wirklichkeit. Macht keinen Unterschied. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8762 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

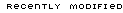
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||