
 |
... Vorige Seite
Sonntag, 20. Februar 2005
Berlinale. Tomu Uchida: The Mad Fox (Japan 1962; Forum)
knoerer
08:23h
Die Kamera fährt eine Schriftrolle entlang, die von der Vorgeschichte erzählt. Die Stimme aus dem Off berichtet, was man dann auch erkennen kann, die Bilder, die von rechts nach links abgefahren werden, fügen sich zur chronologischen Folge eines Geschehens. Ein junger Mann sucht und findet in der japanischen Provinz eine Tochter für den großen Wahrsager, der im Realen des Spielfilms (ha, als gäbe es das hier) bald stirbt. Vor dem Sprung aber, der kein Sprung ist, sondern ein Gleiten über die Farbe Rot, ins Reale, das kein Reales ist, sondern in starren Einstellungen eingefangenes stilisiertes Studio-Setting, vor diesem Sprung geht es noch über aufquellenden Rauch und Feuer auf einen Mond zu, über den ein weißer Regenbogen zieht. Was das bedeutet, das fragt der Kaiser, der weiß, dass es etwas bedeutet. Von der Spaltung des Reichs ist die Rede, vom Unglück des Kronprinzen. Der aber gerät, wie die ganze Haupt- und Staatsaktion des Beginns, binnen kurzem aus dem Blick. Der Wahrsager wird ermordet, der Kampf um seine Nachfolge entbrennt. Zunächst scheint die Liebesgeschichte zwischen Sasaki und dem Aspiranten Yasuna nichts als ein Insert ins Politische. Mit dem Tod Sasakis jedoch in blutiger Folter springt sie heraus ins Zentrum des Films, der die Liebe ins Große zieht und die Geliebte erst zur Zwillingsschwester verdoppelt, dann zur Gestaltwechslerin verdreifacht. Es beginnt mit einem Gebet am Grabmal der Vorfahren. Das Bild schlägt um vom naturalistischen Settings ins Gelb einer Bühne, eines Traums, einer Vision, des Wahnsinns, in den Yasuna aus Unglück verfallen ist. Gelbes Blütenmeer vor gelbem Hintergrund, dazu spröder Klagegesang. Und dann beginnt sich unvermittelt ein Teil des gelben Blütenmeers zu drehen, wie auf einer Drehbühne (es ist eine Drehbühne, diese Bewegung wird sich wiederholen). Und dann fällt unvermittelt der Hintergrund und wir sind zurück im Realen, nein, falsch, in der naturalistisch nur scheinenden Welt der Vision, des Traums, des Wahnsinns, die medial aufgefaltet, gebrochen, gedoppelt wird. Yasuna rettet eine alte Frau, die aber ein Fuchs ist. Das zeigt sich (uns, nicht ihm) ein paar Einstellungen später. Eine weiße Gesichstsmaske macht die Füchsin. Als Yasuna selbst fast auf den Tod verwundet wird, pflegt ihn die Tochter der Füchsin, leckt ihm die Wunde und nimmt die Gestalt Sasakis an. Zuvor sieht man die Füchse im wunderbaren Zeichentrick über das Bild huschen, als schwarze Schatten erst, dann als feurige Seelenfünkchen. Yasuna und Sasaki entbrennen in Liebe, die nicht sein darf. Sie richten sich in einer ärmlichen Hütte häuslich ein. Dies aber versetzt Uchida nun ganz explizit auf eine Kabuki-Bühne. Der Vorhang wird aufgezogen, der Hintergrund ist Kulisse, die Hütte Bühnenbild. Das Kind, das die Füchsin und der noch immer im Wahn Gefangene haben, ist Puppe und weint im künstlichen Sirenenton. Es treten, von links, die Zwillingsschwester auf und der Vater. Sie müssen erkennen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Schock der Erkenntis wird Yasuna übers Pergament einer Wand vermittelt, auf das die Füchsin in Sasakis Gestalt mit dem Pinsel im Mund in Tusche die Wahrheit schreibt. Dem Schreiben folgt die Kamera, folgt der Blick Yasunas – von jenseits des Pergaments. Aufgetragen wie von Geisterhand werden die Schriftzeichen, man sieht nur den Schatten der Füchsin. Aus dem Off der Gesang eines Mannes, der kommentiert, was geschieht. Dann fliegt die falsche Sasaki davon als weißer Fuchs in den Bühnenhimmel. Ein ungeheurer Moment folgt auf den nächsten. Es fällt, von Schnüren gezogen, das Haus als Kulisse in sich zusammen. Rückkehr in den gelben Zwischenraum des Blütenmeers als Bühne. Marionetten-Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Und dann noch eine letzte Einstellung, ein Stein auf der Bühne, die Feuer-Seelenfünkchen und ein letzter Kommentar, der die Moral von der Geschichte präsentiert: Die Liebe ist ein Ding der Unmöglichkeit. ... Link
Berlinale. Karim Asif: Mughal-e-Azam (Indien 1961, Retrospektive)
knoerer
07:32h
Erst spricht, über mittelalterliche Dächer ragend, Indien. Die allegorisch donnernde Art, mit der hier die Geschichte als Erzählung einer Legende auftritt, hat kein fundamentum in re der Chroniken, aber das tut nur soviel zur Sache, dass es schon passt. Die Legende freilich vom großen Mogul und Anarkali, der Frau, die nicht Königin werden darf, die gibt es – und Karim Asif, der sie in diesem alle finanziellen Dimensionen sprengenden Film ein weiteres Mal mit dem Gestus des Definitiven erzählt, er hat das Ende verändert, man wird nicht sagen können zum Besseren. Da mag Indien zuletzt noch so dröhnend als Fürsprecher des Legendenfrevels auftreten. Ein rechtes Melodram geht so nicht aus. Etwas ungelenk, weil von der eigentlichen Geschichte, auf die er sich dann bald doch konzentriert, ein wenig ablenkend, beginnt mit der Vorgeschichte um den Kronprinzen Salim der Film. Dann aber stürzt er sich ins Abenteuer eines Kinos der Fülle, das man so radikal umgesetzt kaum ein zweites Mal zu sehen bekommt. Die Enge des Raums – von wenigen Schlachten abgesehen, die jedoch auch auf eher eng kadrierten und so heftig dynamisierten Feldern stattfinden – drängt das Volle noch voller zusammen. Alles ist Ornat und Ornat wird so Substanz. Das findet seinen Höhepunkt in der atemberaubend verspiegelten ursprünglichen Farbszene zum Ende des ersten Teils – und seinen Widerspruch in der Massenszenerie von Salims Hinrichtung, mitsamt dem wuchtig-traurigen "Zindabad, Zindabad"-Song. Hier drängt die Fülle ins Epische, sonst aber ins Innere einer verbotenen Liebe, deren Inneres aber in aller Konsequenz nach außen gewendet wird. Lesbar, spürbar, sichtbar macht Karim Asif diese Liebe in Großaufnahmen, vor allem von Madhubalas Gesicht, die man zu den großartigsten Affektbildern der Filmgeschichte zählen darf. Die Leinwand wird Gesicht, das Gesicht wird Leinwand, und wenn Salim dies Gesicht zart mit einer Feder streichelnd berührt, dann berührt der Film streichelnd und doch auch überwältigend das Herz des Betrachters. Ein überwältigendes Streicheln: Affekt in der Fülle. Sonst überwiegt in der Überwältigungsrhetorik des Films die Sprache der Pracht. Das Glitzern der Diamanten, das Streuen der Perlen, Säulen, Gärten, Wasser, Vorhänge, das Licht. Abrupt, vom Sturz aus der Fülle in die Fülle, die Übergänge, als sammelte sich über den Brüchen, die die melodramatischen Aufwallungen verbinden, stets neue Kraft. Fülle keineswegs nur im Bild. An Metaphern und Wortspielen und glitzernden rhetorischen Argumenten um Blüten und Dornen und an mehr als Fragmenten einer poetischen Sprache der Liebe reich sind die Dialoge, die sich zum eigenen Strom formen, blitzende Sprach- und Gedankenmusik, die mit den Strömen der Musik und des Gesanges immer wieder zusammenfließt. Das Strömen endet nie, in "Mughal-e-Azam", irgendetwas strömt immer und in dieser Häufung der Fülle kommt man mit dem Gefühl oft kaum nach. Im Ansturm der Bilder und Worte und Klänge wird das Herz so windelweich geprügelt, dass es wie betäubt sich nach Ruhe sehnt. Allein, es gibt keinen leeren frame in diesem Film, noch das flüsternde Kitzeln des Gesichts mit der Feder rauscht wie Meeresbrandung übers Gemüt. Die zur Farbe weniger re- als instaurierte Fassung, die ich gesehen habe, erschöpft gewiss noch einmal mehr. Der vielfach beschriebene Effekt des Falls in den Rausch der Farbe in Anarkalis Spiegeltanz vor der Pause bleibt naturgemäß aus. Beim Schichten von Brocken auf Brocken gerät die Geschichte der Liebe, die Geschichte des einen, nur menschlichen Körpers, der zwischen den zwei Körpern des Königs, des Kronprinzen und der Mutter zerrieben wird, rasch aus der Balance. Unter der manifesten Wucht seiner Inszenierung bricht der Plot immer wieder in sich zusammen, vergisst sich im Wettstreit des Liebesgesangs, im Donnern des Vaters, im Blitzen der Diamanten. "Mughal-e-Azam" zerfällt und richtet sich wieder auf, splittert auf in funkelnde Einzelteile und tönerne Wucht, strömt und erstarrt, verliert sich in der Fülle des Stillstands, gewinnt dann wieder Kraft und Gewalt aus dem Gesicht von Madhubala oder dem kurzen Innehalten der Musik. Dieser Film ist ein heiliges Monster. Nicht das, was man ein Meisterwerk nennt, aber ein Ding wie kein anderes. ... Link Freitag, 18. Februar 2005
Berlinale. Gu Changwei: Peacock (China 2004)
knoerer
11:54h
Drei Geschwister, chinesische Provinz, siebziger Jahre. Von diesen Äußerlichkeiten aus arbeitet „Peacock“, das Regiedebüt des Kameramanns Gu Changwei nach einem hervorragenden Drehbuch von Li Qiang, so entschieden wie sorgfältig nach Innen. Er erzählt die Geschichte einer Familie, so einfach kann man es sagen, so einfach geschieht es. Im ersten Teil konzentriert er sich auf die Tochter, aus der Großes werden könnte. Sie sprengt die Grenzen, die das Elternhaus, das Dorf, die Konventionen ihr setzen. Eines Tages landet neben ihr ein Fallschirmspringer auf der Wiese, der weiße Schirm senkt sich auf sie, sie befreit sich und will als Fallschirmspringerin zum Militär. Das Vorhaben scheitert, keine große Geschichte, aber es wird die Geschichte ihres Lebens. Der eine ihrer beiden Brüder ist fett, er ist geistig zurückgeblieben, er wird von allen gehänselt. Sein Bruder, seine Schwester schämen sich für ihn. Eines Nachts, der Film erzählt auch das mit dem ihm eigenen Understatement, wollen sie ihn vergiften. Die Mutter bemerkt es und am nächsten Morgen vergiftet sie vor den Augen der Beinahe-Mörder eine Gans. Sie stirbt, die Kamera verweilt auf dem Tableau, zeigt, wie das Tier sich windet, aber im rechten Moment, noch bevor sie tot ist, wird abgeblendet. Das ist die große Kunst von „Peacock“: Das Gefühl für das Abblenden im rechten Moment, für das Zeigen im rechten Maß, für das Schweigen da, wo es angebracht ist. Nicht einmal hascht dieser Film nach einem Effekt, nicht einmal glaubt er, etwas explizieren zu müssen, das sich auch implizit zeigen lässt. Er ist nüchtern bis ans Herz und doch nicht kalt. Er hat Mitleid mit den Leidenden und sucht nicht ein bisschen nach einer Versöhnung, die immer nur falsch sein müsste. Der Kameramann Gu Changwei entwirft als Regisseur und mit Hilfe seines Kameramanns Yang Shu Bilder, die nicht aus sich heraus beeindrucken wollen, sondern einfach präzise sind, die zeigen, ohne den Zuschauer zu irgendetwas zu nötigen. Nicht zu Tränen, nicht zu Mitgefühl, nicht zum Hass auf die Borniertheit der ganz normalen Unmenschen, die man hier sieht. Allen lässt der Film Gerechtigkeit widerfahren. Die Eltern, die der Tochter und dem jüngeren Sohn das Leben zur Hölle machen, lieben den behinderten Sohn bedingungslos. Und umgekehrt: Die Tochter, die in dem ihr gewidmeten Kapitel das Mitsehnen und Mitgefühl auf sich zieht, scheut vor dem Mordversuch an dem Bruder, den sie sonst immer zu verteidigen sucht, nicht zurück. Erzählt wird die Geschichte vom kleinen Bruder, der sich in einem sparsam eingesetzten Voiceover-Ich aus dem Off erinnert. Fast ist die Stimme wichtiger als das, was er sagt. Diese Stimme ist, wie der Film „Peacock“, auf eine sanfte, aber tiefe Traue gestimmt. Er erzählt von der Vergangenheit ohne den leisesten Anflug von Nostalgie. Es ist ein Film, der seine Größe niemandem aufnötigt, und umso nobler ist er. An keiner Stelle erweitert er die Möglichkeiten des Kinos, das ist wahr. Aber er besitzt eine Sicherheit im Ton, im Rhythmus, im Maß der einesetzten filmischen Mittel, die ihn im Umfeld des diesjährigen Wettbewerbs doch zu einem Ereignis macht. Und noch etwas: Bei aller Bewunderung für den einen Ton, auf den Julia Hummer und Sabine Timoteo ihre Figuren in Christian Petzolds „Gespenster“ zu stimmen verstehen. Die Leistung von Zhang Jingchu in der Rolle der Schwester (alle Figuren bleiben namenlos) überragt alles, was ich an nuancierter Ausdrucksfähigkeit in der letzten Woche gesehen habe. Sie macht, wie der ganze Film, gar nicht so viel. Wie aber fast unvermerkt die Verwandlung von der lebenslustigen jungen Frau zur etwas verhärmten Geschiedenen in ihrem Gesicht, in ihrer Körperhaltung sich abspielt, das ist von jener Überzeugungskraft, die im Unspektakulären liegt und eben darum gerne übersehen wird. ... Link
pflichttermin
knoerer
07:46h
Dafür geb ich nicht nur meinen rechten Arm, oder war es der linke, sondern die halbe Berlinale her: Am Sonntag Abend ein Edgar-Selge-Polizeiruf (ohnehin fast immer großartig), diesmal gedreht von Dominik Graf. Nur so als Hinweis. ... Link
Berlinale. Nobuhiko Obayashi: Riyuu (Japan 2004, Panorama)
knoerer
07:44h
Vier Tote, ein komplizierter Mordfall, bei dem die Dinge anders liegen als man denkt, und seine gründliche Aufarbeitung. Es gibt zwei ermittelnde Polizisten, es gibt einen Kreis von Verdächtigen. Dennoch ist "Riyuu" kein Film, der den Konventionen des Kriminalgenres gehorchte. Schon deshalb, weil der Kreis der Verdächtigen um einen Kreis der Beteiligten, der Nachbarn, der Zeugen und weiterer Personen erweitert wird, denen teils ausführlichere Porträts gewidmet sind. Dieser Mord berührt, wie sich zeigt, eine Unzahl von Personen, mit großer Geduld öffnet der Film eine Tür nach der anderen, zeigt, erzählt, berichtet. Man verliert irgendwann ein wenig den Überblick, aber das ist durchaus Absicht, es macht nichts, ja, es mindert nicht einmal die Spannung, mit der man dieser Entfaltung bis zuletzt folgt. "Riyuu" gibt sich als Mischung aus Dokufiktion und Spielfilm. Ein Filmteam sucht die Beteiligten auf, rekonstruiert das Geschehen, führt Interviews. Die Dokuszenen gehen bruchlos in die Spielfilmszenen über und der Film unternimmt keine besondern Anstrengungen, den Fake-Charakter der Dokumentation zu verhehlen. Dafür leistet er sich kleine Scherze wie den, immer wieder jemanden ins Zimmer treten zu lassen, der dem Dokufilm-Team, das man nicht sieht, etwas zu trinken anzubieten. Das geschieht aber eher nebenbei, es ist ein Spiel, kein Ernst gemeinter Kommentar zum Verhältnis von Dokumentation und Fiktion. Liebenswert ist "Riyuu" für seinen hübsch unterkühlten Humor, auch für den Sinn fürs Detail, der sich beispielsweise in einem rosa Kleidchen fürs Telefon, das man nur ganz kurz zu Gesicht bekommt, ebenso ausdrückt wie in der sanft verstrubbelten Frisur des Hausmeisters, der nachts aus dem Bett geholt wird. Man hat mit Nobuhiko Obayashis "Riyuu" zudem das seltene Erlebnis, von einem Film in seine ganz eigene Welt gezogen und dann auch auf die Länge von 160 Minuten in ihr geradezu aufgehoben zu werden. Dem Dokucharakter zum Trotz setzt die kluge Regie ihre Authentizitätssignale stets nur zum Schein. Es dominieren die falschen Farben, körniges Bild-Geriesel, und immerzu spielt die Musik dazu. Ich kann mich täuschen, aber mir scheint, es bleibt kein einziges Bild ohne Musik. Erstaunlicherweise ist das hier eine wunderbare Sache. Es funktioniert ein wenig wie bei Wong Kar-Wei, als der noch nicht ins Kunstgewerbe weggedriftet war. Die Musik signalisiert nicht, was wir fühlen sollen, sie verdoppelt nicht das, was ohnehin zu sehen ist, sondern sie hat eigenweltstiftende Funktion. Der Film schafft sich und uns und seiner Geschichte einen eigenen Kosmos, entfaltet ihn mit großer Sorgfalt. Das Genre des Kriminalfilms hätte sich eine solche Variation nicht träumen lassen. Was kann man über Genrefilme besseres sagen? ... Link
da haben wir gelacht
knoerer
07:02h
Wie verfilmt man das Grundgesetz? Das Film- und Kulturprojekt GG 19 zeigt den Weg auf: 19 junge Regisseurinnen und Regisseure aus ganz Deutschland werden zusammen mit dem Filmproduzenten Harald Siebler im Sommer 2005 die 19 Grundrechte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in 19 kurzen Spielfilmen kuenstlerisch umsetzen. Der Episodenfilm soll 2006 in die Kinos kommen. Dramatisch, komisch, originell und beruehrend erzaehlen die Drehbuecher von der Vielfalt und Kraft der Grundrechte und eroeffnen eine neue Diskussion um Anspruch und Wirklichkeit des Grundgesetzes. Prominente Unterstuetzung bekommt GG 19 von Bundestagspraesident Wolfgang Thierse: „In einer Zeit, in der zwar nicht die Zustimmung, aber doch der dauerhafte, aktive Einsatz fuer die Demokratie zu wuenschen uebrig laesst, ist eine Werbung fuer den Sinn der Demokratie mit den kuenstlerischen Ausdrucksformen des Films moeglicherweise Anlass zu Besinnung und Vergewisserung. Denn die Grundrechte, die politische und individuelle Freiheit garantieren, sind doch der eigentliche Grund fuer die Demokratie. Ich sehe dem Projekt "GG 19" mit Interesse und Spannung entgegen.“ Mehr von diesem Kaliber hier. Das ist jetzt nicht wahr. Doch, ist wahr. Muss Satire sein, ist es aber nicht. ... Link Donnerstag, 17. Februar 2005
Berlinale. Raoul Peck: Sometimes in April (USA 2005, Wettbewerb)
knoerer
12:12h
Keine Kritik, sondern eine Kritikverweigerung. Nach drei Minuten den mir im Grunde sehr fremden, jetzt plötzlich fast unwiderstehlichen Drang verspürt, laut loszubuhen. Das war, als auf die dräuenden Trommeln über der Landkarte von Afrika, auf die die Kamera zuzoomt, ein Landschaftsbild folgt, etwas fettärschig Orffmusikartiges gesetzt hat. Es folgen Schmierendarsteller, in deren krampfhaft sich zum Schauspielern verzerrenden Gesichtern nur der Wunsch zu lesen ist, dem HBO-Publikum diese wirklich (drei Ausrufezeichen) böse Sache in Ruanda nahezubringen. Irgendeine Geschichte mit Brüdern wird angeleiert, aber ich fühle mich nervlich nicht mehr imstande, all diesen dummen Plot-Krücken noch irgendwohin zu folgen. Kämpfer werden ausgebildet und ich kann mir nur ausmalen, wie Raoul Peck, dessen "Lumumba" nach vielen, teils auch ganz plausiblen Berichten kein schlechter Film ist, seine afrikanische Darstellertruppe versammelt und das Kommando gibt, dass sie jetzt Soldatenausbildung spielen sollen, für das amerikanische HBO-Publikum Bin ich der einzige, der das nur noch obszön finden kann? Jedenalls bin ich der einzige, der nach dreißig Minuten den Saal verlässt. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8763 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

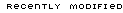
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||