
 |
... Vorige Seite
Donnerstag, 17. Februar 2005
bollywood utopie
knoerer
11:44h
Ich wollte noch mal auf die irgendwo da unten verloren gegangene Frage zurückkommen, ob Bollywood und Utopie überhaupt zusammenpassen. Wenn man die Utopie als das zugleich Kontrafaktische und Wünschenswerte betrachtet, warum nicht? Wo wäre die Utopie dann besser aufgehoben als in der Kunst und zwar da, wo diese vertrackte Formen des ausgestellt Kontrafaktischen entwickelt hat. Man muss das nur in der richtigen Weise Ernst genug nehmen. Was mich hier, unter Kritikern, manchmal fast verzweifeln lässt, ist diese gänzlich ernstwidrige Wurschtigkeit, die aus belämmerten Gesichtern spricht. Die Kinoflüchtigen, die nach zehn Minuten aus einem Benning rennen, die applaudieren, als in "Gespenster" der Film reißt, die gegen "The Wayward Cloud" hysterisch lachend nichts einzuwenden haben, als dass sie so was nicht kennen und es deshalb lächerlich finden. Dabei ist es doch so anstrengend, ignorant zu bleiben, es kostet so viel Kraft, auf der eigenen Dummheit zu bestehen. Aber nein, lieber denkt man den Gedanken, den man schon kennt und preist das Bild, das man erwartet hat. Ist ohnehin alles irgendwie egal. Ich fühle mich oft mutterseelenallein, unter Kritikern. Und sehne mich nach S. oder nach dem Häuflein Enthusiasten, die bestimmt gerade die tollen Filme sehen, während mir im Wettbewerb die Tränen der Verzweiflung die Wangen herunterlaufen. ... Link
schreibzimmer
knoerer
11:26h
Was ich immer noch nicht weiss, ist, wo man auf einer englischen Tastatur, die per Software auf deutsche Tastatur umgestellt ist (eine Emulation also), die Zeichen findet, für die es keine Tasten gibt. Wo also auf der Hardware-Tastatur einfach nichts ist, das blanke Nichts. Komisches Kastrationsgefühl. Konkretes Problem: das < und das >, für die ich softwareseitig auf Englisch zurückstellen muss. Vor ein paar Tagen einen Kollegen von der Westfälischen Rundschau erlebt, der wohl das erste Mal mit Email in Berührung kam, weil im Hotel das Telefon streikte, jedenfalls hat er das dem freundlichen Helfer hier erzählt, fragen Sie mich nicht. Und soeben ein anderer Herr neben mir, der sich auch helfen lässt und nicht recht versteht, was die freundliche Helferin damit meint, dass man den Text entweder in der Mail oder als Datei im Anhang verschickt. Er ist, ich höre es, als er ihr die Email-Adresse nennt, an die sie die Mail so schicken soll, wie sie es für richtig hält, für die Westfälischen Nachrichten tätig. Westfalen, sag ich nur. Vor ein paar Tagen, es war ein sehr grauer Nachmittag, einen sehr grauen Mann, begleitet von zwei überaus unauffälligen Personenschützern, aus den Arkaden kommen sehen. Es war kein Filmstar, sondern das Gegenteil davon: Hans Eichel. Wie ich aus der Welt da draußen, die ich derzeit vor allem von Spiegel Online kenne, von Fischer unter Druck etc. lese und immer nur murmeln kann: Mann, ist er wieder fett. Und dann horche ich in mich und denke nur, soll er halt zurücktreten. Es ist mir egal, er ist mir egal. War auch nicht immer so. ... Link
Berlinale. Lee Yoon-ki: This Charming Girl (Korea 2004, Forum)
knoerer
11:15h
Die Bilder verschweigen nicht, dass da mehr ist als die Gegenwart des charmanten, stillen Mädchens, die sie zeigen. Dass sie aber dieses Mehr nur flüsternd zeigen, dass sie kaum sprechen und es doch nicht verschweigen, das nimmt ein für „This Charming Girl“, so lange dieses Flüstern währt. Die Kamera, in bewegter Nähe zum Gesicht, zum Körper, zum Hinterkopf, zum Gang des Mädchens durch die Straßen der Stadt, ist unaufdringlich, aber interessiert. Das ist mehr als eine Geste der Beobachtung, es ist in seiner Konsequenz ein Verhältnis, das sie eingeht – und das sie dann verrät in dem Moment, in dem sich alles klärt. Von einer Minute auf die andere verliert der Film seine Ambivalenz, ganz und gar. Was vorher Neugier war, Zärtlichkeit, was in seiner vorsichtigen Darstellung eines Alltags, im Postbüro, mit dem Ex-Mann, mit dem Schriftsteller, der regelmäßig zur Post kommt und das Rendezvous nicht einhält, zum leisen Porträt sich fügte, all das ist mit einem Schlag, mit einem Bild vereindeutigt. Es ist nicht so, dass dieses Ereignis, an das die Protagonistin sich erinnert, sich erinnern muss, nicht schockierend wäre, im Gegenteil. Der Riss im Film, der Schlag, sie wären gerechtfertigt. Als Riss aber, als Schlag tritt die Erinnerung hier nicht ein. Der Film macht zunächst weiter wie zuvor. Die Ernüchterung liegt im Auge des Betrachters, der nun, in diesem Moment erst, begreift, dass der Film von Anfang an nur auf diese Erinnerung hinaus wollte, dass alles, was geschah, sich nun rückblickend ganz einfach verstehen lässt. Die in Luft aufgelöste Ambivalenz führt zur manifesten Enttäuschung. Die Kunst der Schwebe, die einen lange fasziniert hat, erweist sich als Kunstfertigkeit, die auf schlichtem psychologischem Grund gebaut war. Man hätte sich so sehr gewünscht, es gäbe hier kein schwer wiegendes Geheimnis. Von dessen Offenbarung aber erholen die Figur, der Film, der Zuschauer sich nicht mehr. Zumal das Buch dann mit einer Wendung in Richtung Thriller fortfährt. Nicht, dass der Regisseur nicht auch hier ganz famos Töne zu setzen, Atmosphäre zu erzeugen und den Klang der Natur vibrieren zu lassen verstünde. Nun aber handelt es sich nur noch um die Umsetzung eines Traumas in Bild und Ton und gerade im Gekonnten dieser Inszenierung auch um eine Verharmlosung des Schreckens. Kurz stockt einem der Atem, als zuletzt die perlende Piano-Musik wieder einsetzt. Der falschen, weil allzu leichten Versöhnung weicht „This Charming Girl“ in letzter Sekunde noch aus, aber nur um Haaresbreite. Ein durch Ambivalenz zunächst wunderbarer Film nähert sich, weil er nach thematischem Gewicht sucht, der leichtfertigen Konfektion. Eine vertrackte Sache, aber auch sehr lehrreich. ... Link
Berlinale. Tsai Ming-Liang: The Wayward Cloud (Taiwan 2005)
knoerer
07:24h
Boy meets girl und geht dabei über Leichen. Nein, das stimmt nicht: Es ist nur eine Leiche, aber das macht die Sache nicht besser. Das eigentliche Problem ist freilich, dass auch Tsai Ming-Liangs "The Wayward Cloud" über eine Leiche geht und man nicht sagen kann, weil es der Film selbst auch nicht sagt, ob er das Entsetzliche, was geschieht, denunziert oder selbst am Entsetzlichen Teil hat, und sei es nur über die Bilder, deren Anstößigkeit er nutzt, um selbst zum Höhepunkt, der das Ende ist, zu kommen. Es gibt drei Arten von Bildern in "The Wayward Cloud" und im Grunde auch drei Filme, in die er weniger zerfällt, als er die Frage nach dem Zusammenhang dieser Filme ständig vor sich her schiebt, um zuletzt zu einer außerordentlich verstörenden Antwort zu kommen. Film eins ist die Geschichte von Boy meets Girl. Sie sehen sich wieder, auf einer Schaukel. "Verkaufst du noch Uhren?" fragt sie und es wird klar, dass es sich um das Paar aus Tsais "What Time is it there?" handelt. Gespielt wiederum von den Schauspielern Lee Kang-sheng und Chen Shing-chyi, mit denen der Regisseur immer wieder arbeitet. "Nein", sagt der junge Mann und beinahe reden sie mehr nicht miteinander im ganzen Film. Die Frau trägt als Fetisch, der komödiantisch, aber nicht mit Sinn aufgeladen wird, eine Melone unter dem Herzen. Das Wasser ist knapp, die Melonen sind es nicht. Ein Scherz, ein running gag, der seinen Verzicht auf tiefere Bedeutung ausstellt. Damit könnte man leben. Film zwei zeigt, wie Szenen zu Porno-Filmen gedreht werden, zu Beginn mit einer Melone, die die Darstellerin als ins Große geschwollene Metapher ihrer Vagina zwischen den Beinen hält. Später geht es ohne Melone zur Sache. Der Pornodarsteller ist der junge Mann, der in Film eins zum Sympathieträger durchaus taugt. Das Verhältnis der Bilder Tsai Ming-Liangs zu diesen Porno-Bildern jedoch bleibt unklar. Oder nein: Eigentlich erlaubt er sich mehr als einen Scherz zu viel auf Kosten der armseligen Bedingungen, unter denen hier gedreht wird, um nicht selbst, mit Absicht oder nicht, in den Porno-Dreh hinein zu geraten. Film drei ist sozusagen die Ausfaltung der metaphorischen Melone der ersten Pornoszene: In Zwischenstücken hält der Film inne und bricht in Gesang und Tanz aus, zunächst als Solo des Protagonisten, später mit Melonenschirmen und schwer angeschrägten Tiller Girls, die zwischen Camp und Busby Berkely zu Cantopop der gefälligen Art choreografiert werden. Die Ambivalenz dieser Inszenierungen kann man durchaus genießen, wenngleich auch hier das Mulmige dem Vergnüglichen sehr eng benachbart bleibt. Drei Filme also. Am ersten lässt sich die beträchtliche, immer wieder auch recht großartige Überraschungseffekte Inszenierungskunst Tsai Ming-Liangs genießen, am dritten der Wille zur grotesken Überschreitung der von ihm bisher gepflegten Konvention des stillen, fast dialoglosen Kunstfilms. Mit diesen beiden allein überragt "The Wayward Cloud", von "Gespenster" mal abgesehen, den bisherigen Wettbewerb an Kunstverstand um ein Beträchtliches. Der zweite Film aber ist von Beginn an problematisch. Am Ende begegnen sich die drei Filme, sie treffen sich in einer Szene, deren Abgründigkeit außer Zweifel steht. Es beginnt damit, dass die Frau, in die der Protagonist sich verliebt hat, im Fahrstuhl die offenbar tote, jedenfalls leblose Pornodarstellerin findet. Sie schleppt sie in ihre Wohnung, sie isst schmatzend eine Melone. Von der Melone und dem Schmatzen ist es nicht weit zur Pornografie, in "The Wayward Cloud". Der Pornoregisseur kennt kein Vertun und lässt seinen Darsteller mit der Leiche weiterdrehen. Das leblose Stück Fleisch genügt allemal, die gefilmte, nicht die filmende Kamera muss nur den richtigen Ausschnitt wählen. So weit, so schrecklich. Hinter der Wand jedoch, in der sich ein vergittertes Fenster befindet, steht die junge Frau und beobachtet den jungen Mann, der die mutmaßliche Leiche vögelt. Ihre Blicke treffen sich. Sie schweigt, die Kamera beobachtet ihre Gesichter, zeigt die Wand, die zwischen beiden liegt. Dann beginnt die Frau orgasmisch zu stöhnen. Der Mann wird zusehends erregt. Er löst sich von der Leiche, stürzt auf das Fenster zu und ejakuliert in den Mund der Frau jenseits des vergitterten Fensters. Lange verweilt die Kamera auf diesem pornografischen Bild. Boy meets Girl. Schnitt. Die Kamera hat ihr Schlussbild gefunden: Von hinten ist die Frau in einer Totalen zu sehen, dahinter, ausgeschnitten durch das Fenster, der Mann, seinen Schwanz in ihrem Mund. Musik setzt ein, Cantopop, der Titelsong "The Wayward Cloud". Die drei Filme sind sich begegnet und ich habe das entsetzliche Gefühl, dass Tsai Ming-Liangs Film, der eigentliche Film, einverständig mit der Pornografie selbst für den Fall, dass er sie eigentlich denunzieren will, im Mund seiner Protagonistin kommt. ... Link Mittwoch, 16. Februar 2005
Berlinale. Wes Anderson: Die Tiefseetaucher (USA 2004)
knoerer
15:02h
Mächtig kommt der Jaguarhai angeschwommen, schön ist er und groß. Er dreht ein paar Runden, leuchtet und schwimmt wieder davon. Nichts ist passiert. (Natürlich gibt es gar keinen Jaguarhai, in Wirklichkeit.) Im Grunde lassen sich die Ereignisse in jedem Wes-Anderson-Film so zusammenfassen: Etwas kommt gewaltig, dreht eine Runde und verschwindet wieder. In „Die Tiefseetaucher“ ist es nur eine Szene, der Höhepunkt, wenn man so will, aber im Grunde taugt fast jede Szene in den Filmen von Wes Anderson als mise-en-abyme seiner Filme. Mise-en-abyme: Der Film wird in den Film zurückgefaltet, das Bild findet sich im Bild und im Bild im Bild ist dasselbe zu sehen wie im Bild selbst. Man kann mit dieser Struktur glücklich werden und man kann der Meinung sein, dass es irgendwann nervt. Immer neue Anläufe, aus denen nichts wird, aus denen nichts folgt. Manchmal keine Anläufe, sondern einfach nur ein Schnappschuss, aus dem auch nichts folgt (das sind vielleicht die hübschesten Szenen): Steve Zissou (Bill Murray), den man zwei Sekunden lang sieht, wie er einen großen Fisch füttert. Das war’s. Manchmal dauert es länger und scheint nichts anderes im Sinn zu haben, als eine Pointe zu zerreden, zu verfehlen oder zu versenken. Wes Anderson ist ein Meister des zerschriebenen und unterspielten Gags. Fragt sich nur, ob das nicht eine Meisterschaft in einer etwas überflüssigen Disziplin ist. Zur Welt, wie wir sie kenne, haben die Welten, die Wes Anderson baut, besser sollte man sagen, die er bastelt, eine reichlich gestörte Beziehung. Sie sind mit sich selbst enger verwandt als mit dem, was man vorläufig mal die soziale Wirklichkeit nennen könnte. Darum geht es immer wieder um Vaterschaften, umstrittene, falsche, richtige, ungeklärte, um Väter und Söhne, ein fortzeugen, das nichts anderes bewirkt als eben die Fortzeugung. So auch hier. Steve Zissou ist eine Art Jacques Cousteau als Knallcharge, Anführer eines multinationalen Teams von Tiefseefilmern mit roten Mützen. Sie alle haben bessere Tage gesehen. Eines Tages taucht ein junger Mann auf (Owen Wilson), der der Sohn einer ehemaligen Geliebten Zissous ist. Er nimmt ihn ins Team. Auch eine Reporterin taucht auf (Cate Blanchett), natürlich ist sie schwanger. Einen Plot gibt es dabei nur mal eben so, als lässig zusammengestrickte Konzession an gewisse Erwartungshaltungen. Ein bisschen „Moby Dick“, ein bisschen Piraterie, der Jaguarhai. Dazu immer wieder Popmusik, ein Highlight dabei die portugiesisch zerspielte und zersungene Version von David Bowies „Space Oddity“, in deren Hintergrund der Piratenüberfall beginnt. Die Piraten kommen gewaltig, es wird geschossen, dann sind sie wieder weg. Das wiederholt sich mit Variationen. Alle sehen sehr lächerlich aus. Es ist schön, Jeff Goldblum mal wieder zu sehen. Und der Originaltitel, der ist toll: „The Life Aquatic with Steve Zissou“. Sonst aber: ein Bild im Bild im Bild. Irgendwann ist der Film aus, der Sohn auf den Schultern des Mannes, der nicht sein Vater ist. Es zeugt sich fort. ... Link
Berlinale. Li Yi-Fan, Yan Yu: "Before the Flood" (China 2004)
knoerer
07:54h
Es ist das größte Staudamm-Projekt der Welt, ein ganzes Tal des Jangtse-Flusses soll dafür geflutet werden. Ökologen und Geologen warnen seit Jahren von den möglichen Folgen, allein es hilft nichts. Bis zum Jahr 2009 soll der Staudamm fertig werden. Li Yi-Fans und Yan Yus Film "Before the Flood" befasst sich mit diesem monströsen Projekt, jedoch in weiser Beschränkung auf eine einzige Frage: Was bedeutet es für die Bewohner der alten, am Jangtse gelegenen Stadt Fengjie, die bereits 2002 umsiedeln müssen in ein neues, aus dem Boden gestampftes Fengjie? Berühmt ist das alte Fenjie, das es nicht mehr geben, das vom Erdboden getilgt wird, nicht zuletzt, weil hier Li Bai (701-762) lebte, einer der berühmtesten Dichter Chinas. Seiner Poesie wegen ist Fengjie Legende. "Before the Flood" kann nichts anderes konstatieren als die Abwesenheit aller Poesie. An ausgewählten Beispielen lässt er sich ein auf die Details der Umsiedlungsverfahren. Ein alter Mann, der als Besitzer einer Herberge arbeitet, wird diese verlieren und nicht adäquat ersetzt bekommen. Lange Minuten sehen wir die von der Bevölkerung nur widerwillig akzeptierte Lotterie, in der im neuen Fengjie Grund und Boden, Wohnungen und Häuser durch das Los zugewiesen werden. Existenzen stehen auf dem Spiel, die großen Schicksale und das riesige Projekt lösen sich jedoch auf in Gezänk und Streiterei um Kleinigkeiten. Der Größenwahn der Regierung fährt unter die Bewohner von Fengjie nicht wie der Zorn Gottes unter die Städte Sodom und Gomorrha. Die vielen Statuten, die den Anschein eines Rechts, das hier geschieht, erwecken sollen, verwickeln die Menschen, die immer noch auch ganz andere, alltägliche Sorgen haben, in ermüdende Kleinkriege. Die Filmemacher blicken auf das, was sie da erleben – und sie kamen, wie sie sagen, in die Stadt mit der Legende Li Bai im Kopf – mit protokollarischer Nüchternheit. Sie konzentrieren sich auf wenige Personen. Den Herbergsvater, daneben vor allem um eine anglikanische Kirche und deren Führungsgremien, die in erster Linie in Streitereien um Geldfragen, dann um den Abrissauftrag verstrickt sind. Während man argumentiert, klickt und klackt, vom Film beinahe beiläufig ins Bild gesetzt, der Rechenschieber. Die große Flut und das Klicken des Rechenschiebers: So ließe sich der Film resümieren. Ein großes Drama macht er daraus nicht. Es ist traurig genug, wie es ist. Der Untergang einer Stadt ist eine hässliche Angelegenheit, so alltäglich wie endgültig. ... Link
Wettbewerb: Olmi, Kiarostami, Loach: Tickets (Italien 2004)
knoerer
07:53h
Zu den überflüssigsten Dingen im großen, weiten Reich der Kinematografie gehören in aller Regel die sogenannten Omnibus-Filme, für die sich – weil Geld da ist, oder eine Freundschaft oder ein gemeinsames Interesse – mehrere Regisseure zusammentun, um halbe Sachen zu machen. Fast immer sind es Nebenprojekte, Resteverwertungen, lehrreich im Kontrast im besten, belanglos im Regelfall. "Tickets" nun, für den sich die weiß Gott unterschiedlichen Regisseure Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami und Ken Loach zusammengetan haben, ist keine Ausnahme von der Regel: Er tut keinem weh. Aber gebraucht hat es ihn auch nicht. Was ihn zusammenhält, sind die Tickets des Titels. Eisenbahntickets, das ganze spielt in einem Zug, im selben Zug, der nach Rom unterwegs ist. Wir wissen ja, alle Wege führen nachh Rom, auch die von Filmemachern, die durch sonst nichts auf einen Nenner zu bringen sind. Der Einfachheit halber also der Reihe nach: Ermanno Olmi setzt im ersten Teil eine Männerfantasie ins Bild, die weder durch die nicht unbeträchtliche Eleganz, mit der Vergangenheit und Gegenwart, Wirklichkeit und Fantasie verknüpft werden, zu retten ist. Ja, sie ist nicht einmal durch die wunderbare Valeria Bruni-Tedeschi zu retten, die hier diese Fantasie verkörpert. Wie ein Zug frischer Luft dann der Übergang zur Kiarostami-Sektion. Vom schwülen Olmi-Licht ins klare Licht des Kiarostami-Films, dies ist fast ein großer Moment. Es bleibt leider der einzige. Es überrascht ein wenig, wie flott sich der Asket Kiarostami mit seiner Kamera durch den Zug bewegt. Er erzählt von einer herrschsüchtigen älteren Frau und ihrem Zivi; das ist gelegentlich ganz lustig und immerhin nie peinlich. Im Werk des Regisseurs bleibt es freilich eine Bagatelle, dazu eine beträchtliche Abweichung vom Weg ins zunehmend Radikale, den er zuletzt eingeschlagen hatte. Es schließt sich, alles andere als nahtlos, eine Ken-Loach-Episode an, die nur Ken Loach so erzählen kann. Drei schottische Fußballfans auf dem Weg zum Champions-League-Spiel stoßen auf eine albanische Familie und es kommt zu einer Aushandlung zwischen Rassismus und Mitmenschlichkeit. Loach, der an das Gute im Menschen zu glauben nie aufhören wird, inszeniert das mit Humor und mit großer Lust am Schottischen. Das ist nett, aber auch ein wenig penetrant, ein kleines italienisches Märchen vom guten Schotten in uns allen. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8763 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

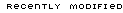
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||