
 |
... Vorige Seite
Dienstag, 15. Februar 2005
Berlinale. Lajos Koltai: Fateless (Ungarn 2005, Wettbewerb)
knoerer
22:19h
Bisher war der Wettbewerb, so weit ich ihn mitbekommen habe, mit ganz wenigen Ausnahmen eine Tortur für die Geschmacksnerven. Auf einen Film wie "Fateless" konnte man dennoch nicht recht gefasst sein. Es fing schon damit an, dass erst "Heights" aus dem Wettbewerb (genauer gesagt aus der ohnehin widersinnigen Rubrik "Wettbewerb außer Konkurrenz") gekegelt wurde, weil Glenn Close ihren Besuch absagte. Aha, durfte man denken, so ist das also: Filme werden hier eingeladen nicht etwa, weil sie interessant sind oder gut, sondern weil man den Star haben will. Sagt der ab, wird auch der Film verabschiedet. Würdelose Veranstaltung, aber wundern kann es keinen, der den Wettbewerb kennt. Was man tat: Man lud als Ersatz einen Film ein, den man bereits abgelehnt hatte. Willkommen auf dem Basar, der Berlinale heißt. Kein geringerer als Imre Kertész, Literaturnobelpreisträger, hatte sich beschwert, dass man die Verfilmung seines "Roman eines Schicksallosen" nicht wollte. Immerhin hat er das Drehbuch dazu geschrieben. Auf der Pressekonferenz, auf der er anwesend war, erfuhr man auch warum: Ein bereits existierendes Drehbuch steuerte mit viel Brimborium und Effekthascherei zielsicher in Richtung Boulevard. Kertész wollte nicht mehr und nicht weniger, als das Schlimmste verhindern. Es ist ihm nicht gelungen – wenngleich sein Drehbuch tatsächlich kaum die Schuld trifft. Man sollte vielleicht wissen, dass Kertész Romanvorlage die Geschichte eines Jungen erzählt, der ins Konzentrationslager von Buchenwald deportiert wird. Er überlebt. Was die Erzählung von seiner Deportation, von seinem Leben im Lager, von seinem Überleben gelingen lässt, ist die Ich-Erzählperspektive. Der Blick bleibt ganz und gar auf den des naiven Jungen eingeengt, der in keinem Augenblick begreift, was ihm wirklich widerfährt. Das Unfassbare wird von einem beschrieben, der es nicht fassen kann und durch seine Ahnungslosigkeit geschützt bleibt. Von einem, der davon sprechen kann, dass es im Konzentrationslager auch Momente des Glücks gegeben hat. Keinem als einem, der es erlebt hat, steht ein solcher Satz zu. Diese Beschränkung auf ein Ich, das erzählt, und in seinem Erzählen die Welt rein subjektiv schildert, ist in der Literatur möglich, im Film ist sie es nicht, schon gar nicht einfach so. Der Zug des Bildes ins Objektive zerstört die Grundvoraussetzung des Gelingens von Kertész' Roman. Nur unter größten Anstrengungen, nur mit dem subtilsten Feingefühl wäre eine ähnliche Beschränkung, eine der Sprache der Vorlage ähnliche Einfachheit auch, vielleicht zu erzeugen. Ein gelegentliches Ich als Stimme aus dem Off, der fortwährende Blick ins Gesicht der Figur, die als objektives Bild an die Stelle des bloßen Ich der Sprache tritt, ist nicht im mindesten ein Äquivalent dafür. Auch einem kompetenten, klugen Regisseur hätte die Umsetzung schwerlich gelingen können. Lajos Koltai freilich ist alles andere als ein kluger Regisseur. Vielmehr gehört er für das, was er mit "Fateless" angerichtet hat, verprügelt. Bisher hat Koltai nur als Kameramann gearbeitet, immer wieder für Istvan Szabo. Sein Film ist tatsächlich der Film eines Kameramannes. Er hat die Kamera seinem jungen Kollegen Gyula Pados ("Kontroll") überlassen, ihn aber dazu gedrängt, möglichst schöne Bilder zu filmen. "Fateless" ist ein Holocaust-Film der schönen, und zwar kitschig schönen Bilder. In Grau und Sepia, aber das gibt dem Ganzen erst recht etwas Altmeisterliches. Untermalt werden die Tableaus aus Buchenwald mit der schwelgerisch elegischen Musik von Ennio Morricone, der immer schon alles vertont hat, was ihm vor die Feder kam, vom Softporno zum Holocaust. Klingt alles ähnlich. Dank Lajos Koltai sieht es jetzt auch ähnlich aus. Die vom Regisseur auf der Pressekonferenz gewählte Auslucht, es handle sich bei dem, was man sieht, eben um den Blick des Jungen, ist hanebüchen. Die Bilder, die man zu sehen bekommt, sind als schwelgerische, von elegischer Musik unterlegte Bilder objektive Bilder. Man muss kein Medienwissenschaftler sein, um das nicht nur zu sehen, sondern auch sehr unmittelbar zu spüren. In einer der sadistischen Quälereien im Lager müssen die Gefangenen in Wind und Regen auf dem Hof stehen, bis sie umfallen. Wer umfällt, stirbt. Wie hübsch das anzusehen ist in "Fateless". Und wie pittoresk der Schnee flockt, wie eindrucksvoll die nackten Leichen ins Bild gesetzt sind. Wie heimelig es im Lager zugeht. Noch die Maden im Knie des Helden sind ästhetisch ansprechend fotografiert. Das durchgehende Stilmittel der sanften Schwarzblende, das die schönen Bilder des Grauens zäsuriert, ist von einer Eleganz, die einem kalte Schauer über den Rücken jagt. Zynismus ist nicht angebracht. "Fateless" ist ein Desaster, das man im besten Fall durch Dummheit entschuldigen kann. Imre Kertész, der den Film verteidigt, ist der Vorwurf zu machen, dass er von der Ästhetik des Kinos nichts versteht. Nun gut, er ist Literat und hat vom Film wohl ohnehin keine hohe Meinung. Auch er hat leider das Schlimmste nicht verhindert. Lajos Koltai gehört das Handwerk gelegt. Ein Festivalleiter aber, der einen solchen, den Holocaust aufs unwürdigste verharmlosenden Film in seinen Wettbewerb einlädt, ist durch nichts zu entschuldigen. Der Regisseur Christian Petzold hat in einem gestern erschienen Interview an Dieter Kosslick dessen umfassende Gleich-Gültigkeit gerühmt. Es gibt aber Fälle, in denen interesseloses Geltenlassen in Verachtung für die Mindest-Maßstäbe der Kunst wie der Moral umschlägt. "Fateless" ist ein solcher Fall. ... Link
Berlinale. Christian Petzold Gespenster
knoerer
15:53h
Die Türen, die ins Schloss fallen, das Rauschen der Blätter in den Bäumen des Tiergartens, die Musik, die von der Party hinaus dringt, in den Raum der Natur zwischen den Räumen eines Hauses. Als Schlusspunkt der wütende Laut, mit dem eine Geldbörse in einen Mülleimer geworfen wird, wieder im Tiergarten. „Gespenster“ ist ein Film der Geräusche, ein Film, den man über seine Tonspur erzählen könnte. „Gespenster“ ist auch ein Film, den man über seine Schauplätze erzählen könnte. Der Wald, die Natur, der Tiergarten. Hier finden sich Toni und Nina, eine schicksalhafte Begegnung. Ein Schicksal freilich, das einen Sinn fürs Lapidare hat. Sie erklären einander nicht. Sie begegnen sich, sie geraten aneinander und bleiben beieinander, bis sie sich wieder verlieren. Sie sind zwei Mädchen ohne Vergangenheit, die Mädchen, die sich im Wald begegnen, als wäre es ein Märchen der Brüder Grimm. Es gibt den Wald und es gibt die Stadt. Den Tiergarten und den Potsdamer Platz. „Gespenster“ ist aber auch ein Film mit einer Geschichte. Falsch. Mit zwei Geschichten, die einander sacht berühren, im Ton der Erzählung, in den Figuren, am Ort des Geschehens. Die andere Geschichte ist die einer Mutter, die ihre Tochter verloren hat, vor vielen Jahren, in einem Supermarkt. In Nina glaubt sie sie nun wieder entdeckt zu haben, am Potsdamer Platz. In die Geschichte, in der Nina und Toni, die einander nicht kennen und einander nicht erklären, platzt die falsche Mutter, die vielleicht auch die richtige Mutter ist. „Gespenster“ ist eine Liebesgeschichte. In den Geschichten, die sie einander erzählen, erklären sich Nina und Toni ihre Liebe. Aus der nichts folgt, die kein Fundament hat, kein anderes jedenfalls als die Gegenwart, in der sie sich ereignet. Nina rettet Toni, Toni rettet Nina. Die Geschichten, die sie sich erzählen, die Geschichte von einer Rettung zum Beispiel, sind nicht wahr. Ein Traum, eine Lüge, aber wahr sind sie dennoch. Die schönste Szene zeigt Nina und Toni nebeneinander, bei einem Casting für einen Film (oder eine Fernsehsendung, egal), sie tragen schon die Produktions-T-Shirts: „Freundinnen“. Toni erzählt ihre Lügengeschichte, Nina erzählt den Traum, in dem Toni auftritt als Königin. Die Kamera liebkost die Gesichter zweier wunderbarer Schauspielerinnen, die Gesichter von Sabine Timoteo und Julia Hummer. In dieser Liebkosungen, in weiteren dieser Liebkosungen ist „Gespenster“ ein großer Film. Im ganzen ist er das nicht. So wundervoll die Tonspur ist, so sehr sie dazu einlädt, die Augen zu schließen und diesen Film einfach nur zu hören, so klar die Bilder sind, so wunderbar Christian Petzold (wie immer dramaturgisch beraten von Harun Farocki) seine Motive gegeneinander balanciert, so großartig die Schauspielerinnen sind und so wenig man die filmische Intelligenz dieses Regisseurs übersehen kann: Es funktioniert im ganzen nicht. „Gespenster“ hat das Zeug zu einem Meisterwerk, aber das ist er nicht. Vielleicht hat es mit dem zu tun, was Christian Petzold in der Pressekonferenz erzählt. Eine Szene, in der einmal die Siegessäule im Hintergrund zu sehen war, hat er sofort in den Müllkorb geworfen. Dem Zufall, der ein Klischee auf die Leinwand befördern könnte, fällt Petzold programmatisch in den Arm. Auf den Millimeter genau will er bestimmen, was zu sehen, auch, was dazu zu denken ist. Das Bild, das er von seinen Figuren im Kopf hat, ist so präzise, dass er genau weiß, welche Zufälle die richtigen und die falschen sind. Toni ist die Soldatin, die nur in der Gegenwart lebt. Von dieser Idee lässt er nicht. Nichts, das dieser Idee womöglich nicht entspricht, hat Raum in seiner Geschichte. Den Gespenstern, deren Geschichten er erzählt, nimmt er so die Freiheit, anderes zu bedeuten, den Figuren, anderes zu tun, als er für sie vorgesehen hat. Christian Petzold weiß alles ganz genau, vielleicht zu genau. Vielleicht darf man aber auch als Autor und Regisseur nicht alles wissen, vielleicht muss man den falschen Zufall zulassen und Bilder, die abweichen von denen, die man im Kopf hat. Erst dann erwacht eine Geschichte, erwachen auch Untote zum Leben. ... Link Montag, 14. Februar 2005
Berlinale: Robert Guédiguian: Le Promeneur du Champ du Mars (F 2005)
knoerer
15:16h
Robert Guédiguian ist ein linker Filmemacher. Vielleicht scheint es ihm schon deshalb evident, dass man sich heute noch für Francois Mitterand interessieren sollte. Mitterand war der letzte Linke alter Prägung unter den europäischen Staatsoberhäuptern. Ein Linker zugleich, der als Rechter angefangen und als zynischer Monarch aufgehört hat. Ein belesener Linker, der es an Größenwahn und Starrsinn in seinen letzten Jahren nicht fehlen ließ. Es kommt schon ein bisschen überraschend, dass Guédiguians Porträt der letzten Monate des Präsidenten (dargestellt von Michel Bousquet) angesichts dieser Umstände mehr oder minder unkritisch ausfällt. Gewiss möchte sein Biograf, der junge Autor Antoine Moreau, über die Sache damals in Vichy, die Freundschaft mit dem Rechten Bousquet, die Wahrheit herausfinden. Er beißt da aber bis zuletzt auf Granit. Den Rest der Zeit ist „Le Promeneur du champ de Mars“ freilich damit beschäftigt, den sterbenden Präsidenten als weisen alten und seinen Biografen als etwas orientierungslosen jungen Mann darzustellen. Sie sitzen beieinander und reden. Sie gehen spazieren und reden. Sie fahren Auto und reden. Will sagen: Meistens redet Mitterand. Unschlagbar seine Tips, was die Frauen angeht, das erfährt Antoine am eigenen Leib. Es gibt Zitate großer und mittlerer Denker, es gibt Lebensweisheiten der zum Glück nicht ganz trivialen Sorte, aber eigentlich gibt es keinen Grund für diesen Film. Kaum vorstellbar scheint, dass sich angesichts dieser von Bouquet immer an der Grenze zur Charge dargestellten Figur bei anderen als fanatischen Anhängern Mitterands so etwas wie Faszination einstellt – und doch scheint es darauf hinaus zu wollen. Der bloßen Lebenserzählungen wird das halbwegs unglückliche Liebesleben des Biografen auf mehr als unglückliche Weise zur Seite gestellt. Der Film behauptet die Strahlkraft seines Helden und vertraut ihr selbst nicht. Wirklichen Ambivalenzen weicht er immer wieder aus, Mitterand behält durchweg das letzte Wort. „Le Promeneur du champ de Mars“ macht von Beginn an den Eindruck einer einigermaßen kompetent ausgeführten Auftragsarbeit. Warum sie aber über den einen oder anderen Arte-Zuschauer hinaus irgendjemanden interessieren sollte, das ist die eine Frage, die sich so leicht nicht beantworten lässt. ... Link
astrea und celadon
knoerer
12:05h
Aus der Rubrik "Meldungen, die Ihren Kritiker glücklich machen": Eric Rohmer plant eine Verfilmung des Barockromans "Astrea und Celadon", laut Screen Daily: "This is the film that Rohmer never dared to make befor. It will be highly stylised, very pure and idyllic and very sexy." Ich bete zu Gott, er möge Rohmers Gesundheit (er ist jetzt, glaube ich, 84) lange, lange erhalten. Wer Rohmers Perceval Le Gallois kennt, weiß, warum ich schon beim Gedanken ins Schwärmen gerate. ... Link
Berlinale. Yash Chopra: Veer-Zaara (Indien 2004)
knoerer
11:59h
„Veer-Zaara“ ist klassisches Bollywood-Kino in Vollendung. Kaum einer versteht sich darauf so gut wie Regisseur Yash Chopra, der als Produzent mit seiner Familienfirma Yash Raj Film eine der großen Legenden der Bollywood-Geschichte ist. Sein Sohn Aditya Chopra schreibt seit einigen Jahren die Drehbücher zu vielen der Yash-Raj-Filme, teils verfilmt er sie auch höchst erfolgreich selbst. Aditya Chopra hat die Muster, die Klischees und die Plotvariationen, die es im kommerziellen indischen Kino in durchaus überschaubarer Anzahl gibt, offenkundig nicht nur verinnerlicht, sondern versteht sich auf die eigentliche und große Kunst des Systems: Sie in jedem gelungenen neuen Film wieder frisch aussehen zu lassen. Das Budget wie das Handwerk aller Beteiligten kommen ihm bei „Veer-Zaara“ zu Hilfe. Es stecken in dem Film Jahrzehnte der angewandten Publikumsforschung, er ist deshalb ein wirklich ausgereiftes Modell, das spürt man Einstellung für Einstellung. Was er auch zeigt, ist die gelegentlich etwas überraschende Tatsache, dass man mit der denkbar wirklichkeitsfernen Form des Bollywood-Films in denkbar wirklichkeitsferner Darstellung und zugleich großer Direktheit politisch werden kann, ohne dass das ins Verlogene kippen würde. Genauer gesagt ist es dabei sogar so, dass es gerade wegen der Wirklichkeitsferne und Direktheit – und natürlich nur im besten Falle – nicht verlogen ist. Bar jeden Realismus ist etwa der Dialog, in dem die Pakistanerin Zaara den vom Feminismus unbeleckten, sonst aber aufs Patriarchalischste liberalen Vater ihres (noch nicht offiziell) Geliebten Veer darauf aufmerksam macht, dass nicht nur die Söhne, sondern auch die Töchter des Dorfes schulischer Bildung teilhaftig werden sollten. Ein paar Einstellungen und einen Tanz später verkündet der Vater seinen neuesten Plan: Die Errichtung einer Mädchenschule. Natürlich ist das, nach Maßgabe realistischer Personen- und Wirklichkeitsdarstellung, geradezu horrender Unfug. In Wahrheit ist es aber nichts anderes als so nonchalant wie konkret formulierte Utopie, vorgetragen von Amitabh Bachchan, dem größten Star des indischen Kinos und damit dem wahrscheinlich berühmtesten Schauspieler der Welt. Frauen sollten gleichberechtigt sein. Frauen sind genauso klug und genauso fähig wie Männer. Keineswegs ist das die Hauptsache des Films, der die Herzen rühren und die Zuschauer bewegen will. Auch die pakistanisch-indische Versöhnungsbotschaft, auf die alles hinausläuft, ist Hauptsache nur nach Art des Nebenbei, mit dem sich die Wiedervereinigung der Liebenden ganz wie von selbst auch als Versöhnung der geteilten Nation lesen lässt. Selbstverständlich aber bleiben die Liebe und die Rührung, die Trauer und die Beseligung das eigentliche Anliegen von „Veer-Zaara“. Im gelungenen Fall wird in Bollywood der schiere Kitsch zum reinen, unverlogenen Medium des Gefühls wie der Utopie. Verdankt ist das einzig der Künstlichkeit, in die das Eigentliche sich auf ganz vertrackte Art eintragen lässt. Wie aus der Künstlichkeit des Kitsches Gefühle ohne Falsch hervorgehen, das ist das Geheimnis und das Wandlungswunder von Bollywood, das sich in „Veer-Zaara“ durchaus auch erleben lässt. Der Film ist, wie gesagt, Bollywood in Vollendung. In dieser, wenn man so will: altmeisterlichen Vollendung aber stößt dieses Kino inzwischen an seine eigene Grenze. Diese Grenze als eine, die ein Meister wie Yash Chopra in Richtung ungezügelterer Darstellungen nicht überschreiten will und kann, wird in „Veer-Zaara“ dann doch ein wenig spürbar. Der Film bewegt und entzückt, reißt aber kaum einmal hin. Seine Überraschungen sind wohl dosiert, manche der sogenannten Picturizations (also Verbildlichungen der Songs, so heißt der Song-and-Dance sehr zutreffend im Fachjargon) wunderschön und auch klug in der imaginären Darstellung von Wünschen und Ängsten. Das gewisse Etwas an Exzess und Widersinn und Wagemut, das die ganz großen indischen Filme auszeichnet, das fehlt aber. ... Link
Berlinale. Hany Abu-Assad: Paradise Now (Herkunftsland internationaler Produktionssalat 2005)
knoerer
11:26h
Was soll man noch sagen? Soll man es noch einmal sagen? Dass ein Film, der seinen Figuren politische Thesen in den Mund legt und um die Münder herum Darsteller castet und um die Darsteller herum Bilder baut, indem er Kameras in Palästina aufstellt und hinter seinen Darstellern mit den Mündern, aus denen politische Thesen sprechen, mit der Kamera herläuft durch die Straßen der West Bank, dass ein solcher Film das Gegenteil eines politischen Films ist? Dass er, schlimmer noch, auch das Gegenteil von Kino ist und man seinen Machern raten würde, doch einen Zeitungsartikel zu schreiben, wenn, ja wenn sie überhaupt irgend etwas Interessantes mitzuteilen hätten. Soll man es noch einmal sagen und immer wieder sagen und irgendwann einfach nichts mehr sagen, den Wettbewerb abhaken und hoffen, dass die Ära Kosslick möglichst bald vorüber geht, damit man Filme wie „Paradise Now“ nicht mehr im Mittelpunkt eines der großen Festivals der Welt ertragen muss? Was soll man sagen? Soll man es noch einmal sagen: Dass das Gegenteil von gut noch stets gut gemeint war und das Gegenteil von Kunst das sozialdemokratische Verständnis davon? Also, fürs Protokoll. Erzählt wird die Geschichte zweier palästinensischer Selbstmordattentäter, Khaled und Said, der Film zeigt sie am letzten Tag vor dem geplanten Anschlag und am Tag des Anschlags selbst. Ein kurzes Video wird gedreht, in dem sie zum Abschied ihre revolutionären Sprüche aufsagen. Später wird sich die Frau, aus deren Mund der Pazifismus hängt wie in einem mittelalterlichen Gemälde die Erläuterungen auf weißen Bändern aus den Mündern der Figuren hängen, darüber empören, dass man diese Videos in palästinensischen Läden kaufen kann. Der Anschlag wird scheitern, einer der beiden, Said, wird durch die Straßen irren auf der Suche nach der Botschaft des Ganzen, die der Film am Ende salomonisch entzwei teilen wird. Es wäre schon falsch zu sagen, „Paradise Now“ sei ein schlechter Film. Eigentlich ist er, wie gesagt, gar kein Film, sondern der hilflose Versuch, die verteufelte Lage im Nahen Osten irgendwie in Szene zu setzen. Die politische wie die ästhetische Naivität, mit der das geschieht, ist so offenkundig, dass es schon übertriebener Aufwand wäre, sich dem Ganzen ideologiekritisch zu nähern. Wie wenig man komplexen politischen Situationen durch Personalisierung gerecht werden kann, wie peinlich es ist, solche Vereinfachungen durch die obligatorische Liebesgeschichte auch noch in den Kitsch zu treiben, wie albern es ist, aus dem Nichts mal so eben, ohne irgendeinen Grund, eine Abendmahlszene zu inszenieren, muss man das noch sagen? Noch einmal, immer wieder? Ach. ... Link
Berlinale. Liu Jiahyn: Oxhide (China 2004)
knoerer
08:00h
Das schönste Erlebnis, das man auf einem Filmfestival haben kann, ist es, im Kino zu sitzen, nichts zu erwarten, den Film eines völlig unbekannten Regisseurs zu sehen und nach wenigen Minuten zu begreifen, dass man es mit einem Geniestreich zu tun hat. Leider ist das nicht nur das schönste Festivalerlebnis, das sich vorstellen lässt, es ist auch eines der seltensten. Gestern aber ist mir genau das passiert, aus heiterem Himmel, natürlich im "Forum des Internationalen Films", wo sonst. Liu Jiayin ist eine Regisseurin aus Peking, 22 Jahre alt. Sie hat gerade erst mit dem Studium an der Filmhochschule ihrer Heimatstadt begonnen, "Oxhide" ist ihr Debüt. Hergestellt ist es mit den einfachsten Mitteln: Eine Digitalkamera, zwei Mikrofone, die sie sich geliehen hat, ein gutes, sagt sie später, ein schlechtes, daher die Unterschiede im Ton. Für zwei gute Mikrofone war kein Geld da. Es gibt keine Schauspieler, genauer gesagt: Es spielen Liu Jiayin selbst und ihre Eltern (und die Katze). Sie spielen sich selbst. Gedreht ist der Film in der 40 Quadratmeter großen Wohnung, die für keine Einstellung verlassen wird. Die Eltern und die Tochter spielen sich selbst und ihr Leben in der eigenen Wohnung. Große Kunst wird daraus durch die Form, in der die Regisseurin diese nahe liegende Idee umsetzt. Der Film besteht aus 23 Einstellungen, die mit unbewegter Kamera gedreht sind. So radikal wie umwerfend sind die Ausschnitte kadriert. Nie erhält man einen Überblick über die Wohnung, nie bekommt man eine der Personen ganz in den Blick. "Oxhide" ist ein Film, dessen Intelligenz in der Art liegt, in der das Gezeigte und das Nicht-Gezeigte zugleich im Spiel sind. Ein Film, der die platte Abbildung vermeidet, indem er mit großer Bewusstheit und atemberaubender Entschlossenheit den Raum der Familie für die Kamera arrangiert. Nur für den oberflächlichsten Blick kann das kunstlos wirken. Eine der ersten Einstellungen schon macht einem klar, wie präzise Liu Jiayin ihre 23 Kapitel inszeniert. Ins Bild kommen, wie es zunächst scheint, sinnlos zusammengestellte Gegenstände. In der Mitte der Teppich, links ein Foto, rechts etwas, das wie ein Sessel aussieht. Man kann das alles nicht genau erkennen, das Bild wirkt amateurhaft. Im Off unterhalten sich ein Mann und eine Frau. Es geht um Schriftzeichen, um Typografie, die Rede ist auch von einem Discount, man versteht nicht recht, was das soll. Das geht ein paar Minuten so, die Einstellung bleibt unverändert. Dann kommt ein bisher nicht gehörtes Geräusch hinzu, ein rotes Blatt schiebt sich aus dem Sessel, der, wie man nun begreift, ein Drucker ist. Die Stimmen haben über den Laden gesprochen, Zettel, die einen 50prozentigen Rabatt versprechen. Damit ist, aus dem Off, aus dem Drucker, der ein Sessel schien, eines der Leitmotive des Films entworfen. Jede Einstellung des Films ist, wie diese, wenn auch nicht immer mit einem Verblüffungseffekt, von einer formalen Konzentration, die man in der Sprache als gebundene Rede bezeichnen würde. "Oxhide" ist ein Film über eine Familie. Diese Familie, die die Familie der Regisseurin ist. Es geht um den Vater, der Ledertaschen produziert und verkauft, seit Jahren gehen die Geschäfte schlecht, seit Jahren sind sie verschuldet. Man sieht die Familie beim Essen, beim Arbeiten, beim scheinbaren Nichtstun. Der Vater klagt sich an für seinen Misserfolg, er verachtet die Verkaufsmethode, die dem Kunden einen Discount vorgaukelt. Man spricht über die Zeitungsverkäuferin, die plötzlich gestorben ist, Mutter und Tochter beraten, wie man den Geburtstag des Vaters feiern kann. Jede dieser Szenen wirkt, wie man so sagt, ganz wie aus dem Leben gegriffen. Und natürlich sind diese Szenen aus dem Leben gegriffen. Alles, was sie zeigt, wird die Regisseurin erklären, hat sich so oder ähnlich ereignet. Dennoch ist "Oxhide" kein Dokumentarfilm. Liu Jiayin hat ein genau ausgearbeitetes Drehbuch geschrieben, die Szenen lange mit ihren Eltern geprobt, Improvisation gibt es kaum. Die Eltern und die Regisseurin stellen sich selbst und ihr Leben dar, aber als Darsteller ihrer selbst. Die Einstellungen verknappen den Raum und reformulieren in der gebundenen Rede einer hier auf Anhieb fast schon in Vollendung gesprochenen Filmsprache die Wirklichkeit. In keinem der aktuellen Filme der Berlinale habe ich dergleichen gesehen, im Forum nicht und schon gar nicht im Wettbewerb. "Oxhide" ist eines der Wunder, die es ganz selten gibt. Es ist bisher der eine Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8764 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

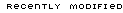
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||