
 |
... Vorige Seite
Sonntag, 13. Februar 2005
noch ein tagebuch
knoerer
14:02h
Wer übrigens auch von der Berlinale bloggt, oder jedenfalls täglich berichtet, ist Alex Waltz bei de-bug. ... Link
Berlinale. Robert Thalheim: Netto (D 2004)
knoerer
13:53h
Robert Thalheim, der sein Studium an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen noch nicht beendet hat, hat für seinen Film „Netto“, der noch nicht einmal sein Abschlussfilm ist, bereits viel Lob erhalten. Ab Mai wird er gar in deutschen Kinos zu sehen sein, der Regisseur wird landauf, landab als großes Talent gepriesen. Man sollte die Kirche im Prenzlauer Berg lassen. Hier ist kein großer Meister vom Himmel gefallen. Die Begeisterung sagt mehr über die Konjunkturen bestimmter Themen und Herangehensweisen an die Darstellung gesellschaftlicher Wirklichkeiten als über den Film. Erzählt wird in „Netto“ die Geschichte eines Ostdeutschen, der den Fall der Mauer als Beglückung erfahren hat. Die Frau, die er liebte, hat ihm einen Sohn geboren, die Zukunft war rosig. Dann ging es bergab und zwar ganz furchtbar. Der Film erzählt in der Gegenwart, wie sein Sohn nach zwei Jahren der Abwesenheit zu ihm zurückkehrt. Die Ehe ist zerbrochen, die Frau ist schwanger, von einem Wessi. Der Sohn flieht, vom neuen Einfamilienhaus in die Bruchbude im Prenzlauer Berg in Berlin, in der sein Vater haust. Der ist eine so traurige wie unglücklicherweise auch unerträgliche Gestalt, sehr ähnlich übrigens bis in manche Details dem Gunnar aus der „Dritten Heimat“. Große Klappe, Selbstmitleid, ständiges Genörgel über die Ungerechtigkeit der Welt und nichts dahinter. Der Sohn hält es kaum aus, hilft ihm bei einer Bewerbung, aus der nichts wird, haut ab, kehrt zurück, verleugnet ihn. Es gibt peinliche Szenen, es gibt lustige Szenen, wie überhaupt das Buch bemüht ist, den kitchensink-Realismus immer wieder aufs Komödiantische hin abzufedern. Eine Liebesgeschichte des Sohnes kommt hinzu, Star Wars, der Mauerpark und vor allem Peter Tschernig, der Johnny Cash der DDR, geben Lokal- und Generationenkolorit. (Ich habe, nebenbei gesagt, nicht gewusst, dass es Peter Tschernig gab, in dessen Gestalt die DDR das Grauen, das den Namen Truck Stop trägt, überholte, ohne es einzuholen. Trotzdem ist es sehr schön, wie der Film mit Tschernig umgeht und darauf verzichtet, ihn zu denunzieren.) Vieles bleibt ungelenk, wie von einem solchen Erstling nicht anders zu erwarten. Wirklich schön, fast schon großartig sind zwei Szenen, in denen die Kamera dem Helden folgt, wie er durch Berlin radelt, in der Nacht. Man hört die Geräusche des Dahingleitens durch die Dunkelheit, fast möchte man sagen: die Geräusche der Dunkelheit. Rabiat geht es dann immer wieder ins Klischee zurück. Aber es gilt auch: Falsche Versöhnungen finden nicht statt. Kein unsympathischer Film. ... Link
Berlinale. James Benning: 13 Lakes,10 Skies (USA 2004)
knoerer
13:15h
Die Filme des Amerikaners James Benning sind kinematografische Grundlagenforschung. Man kann dazu auch Experimental- oder Konzeptfilm sagen, schon weil man die Großartigkeit seines Unternehmens damit präzise zu fassen bekommt. Wenn das „Experiment“ – von lateinisch experiri: erfahren – eine Erfahrung beschreibt und damit einen Vorgang , der sich in der Zeit erstreckt und nach einem Subjekt verlang, das etwas erfährt, dann benennt das Konzept den Begriff, die Idee, die im Entwurf eines Experiments stecken. Das Konzept hat keine Erstreckung in der Zeit und bedarf dieser genau dann, wenn es zu einer Erfahrung führen soll. Das Konzept lässt sich verstehen, aber nicht erfahren. Dass die minimalistischen Konzepte der Filme von James Benning für den Betrachter zu intensiven Erfahrungen werden, das ist die im Kino der Gegenwart wohl einmalige Stärke seines Werks. Das Konzept: Die Titel seiner beiden jüngsten Filme sind so lakonisch wie genau. „13 Lakes“: Zu sehen sind 13 Seen. Jeder See wird von der Kamera aus einem festen Aufnahmewinkel aufgenommen, für je zehn Minuten realer Zeit. Man hört dazu, teils in nicht sehr brillanter Qualität, den Originalton. Ein Grundgeräusch, das nicht aus der Natur, sondern von den Aufnahmegeräten stammt, ist stets anwesend, drängt sich manchmal in den Vordergrund. Die Kamera bleibt starr und es geschieht, was geschieht. Wie man sich vorstellen kann, geschieht nicht viel. Auf den ersten Blick jedenfalls. Still und ziemlich starr ruht der See. Etwas oberhalb der Bildhälfte teilt der Horizont die Leinwand. Im Vordergrund jeweils der See, der Horizont hat die Gestalt von Bergen, einer Hafenbefestigung, auch einer Autobrücke, oder er ist nicht mehr als die dünne Linie, gelegentlich beinahe verschwindend, an der Himmel und Erde aneinander stoßen, ineinander übergehen. Die dreizehn Seen, genauer: die See-Ausschnitte sind ähnlich kadriert. Das Wetter ist unterschiedlich, sie sind unterschiedlich groß und bewegt, aber stets befindet sich der Horizont, als gezackter, gerader, verschwindender, die Grenze einer Spiegelung bildender split im screen. „10 Skies“. Zu sehen sind 10 Himmel (oder Ausschnitte aus zehn Himmeln oder zehn Ausschnitte aus dem Himmel – im Unterschied zum See, der eine Grenze hat, ist ein Himmel niemals vollständig zu erfassen, nicht von der Kamera, nicht vom Denken. In diesem Sachverhalt gründet die Idee der Erhabenheit der Natur bei Kant.). Jeder Himmel wird aus einem festen Aufnahmewinkel aufgenommen, für je zehn Minuten realer Zeit. Die Kamera bleibt starr und es geschieht, was geschieht. Tatsächlich geschieht sehr viel, schon auf den ersten Blick. Wolken ziehen vorüber, formen sich zu Figuren. Man sieht Figuren und Formen entstehen und sich auflösen. Nur einmal kommt eine Art Horizont ins Bild, am unteren Rand des dritten Himmels, die Spitzen der Wipfel von Bäumen. Die Erfahrung: Sie ist, wie jede Erfahrung, an das Subjekt gebunden und für jedes Subjekt eine andere. Ich kenne Menschen, die im Angesicht der Bilder von James Benning in eine Art Rausch verfallen. Ich kann das verstehen, erfahre und erlebe aber eher eine Art Auf- und Abschwünge zwischen Begeisterung und Langeweile. Die stets gleich lange Zeit kann unterschiedlich schnell verlaufen. Ein See ist nicht ein See ist nicht ein See. Der zweite See etwa ist flächig und leer, kontrastiert kaum mit dem Himmel, in den er übergeht. Ein öder See. Ins Grafische dagegen spielt der zwölfte See, an der Kante von Land und Wasser bilden sich in der spiegelnden Verdopplung von Bergen und Bäumen weiße Gravuren, pfeilförmig. Manche Seen und fast alle der Himmel beginnen zu erzählen. Jedenfalls entstehen Abfolgen, Verwandlungen, sich wandelnde Erstreckungen von Geschehen in der Zeit. Einmal fährt auf einem der Seen ein Schiff in den Hafen. Es gerät ins Bild und verschwindet wieder daraus. Das ist die Geschichte, die dieser See erzählt. Am Ende ruht er wieder, als wäre nichts gewesen. Ins Bild hinein gerät eine Bewegung und verschwindet. Die Himmel dagegen sind fortwährend bewegt dank der Wolken. Kürzlich gab es in Hamburg und Berlin eine große Ausstellung von Wolkenbildern in der Malerei, aber keines von ihnen reichte an die Wolkenbilder von James Benning heran. Vor unseren Augen ereignen sich dramatische Figurbildungen und ebenso dramatische Auflösung. Im vierten Himmel formt sich – für mein Auge wenigstens – eine dicke Frau wie von Botero, plötzlich schwill ihr rechtes Bein an, quillt auseinander, explodiert beinahe. Das ist der Splatter-Film, der in „Ten Skies“ steckt. Überaus dramatisch das Geschehen im sechsten Himmel. Von unten her zieht ein grauer Dunst über den von gelegentlichen weißen Wolken besiedelten blauen Himmel. Er zieht nach oben, bis fast die ganze Leinwand bedeckt ist. Bevor das aber geschieht, bevor also ein vollständiger Vorhang das Bild verdeckt, drängt von links unten wieder etwas Leichtes, Helles heran, scheint ohne Mühe den grauen Dunst auflösen zu können. Es folgt eine Schwarzblende. Stets trennen etwa zehn Sekunden lange Schwarzblenden eine Einstellung von der anderen, liegen zwischen See und See, zwischen Himmel und Himmel. Die Bilder, die man sieht, auch die Töne, die man hört (Vogelgeschrei, eine Bahn, die außerhalb des Bildes vorüberfährt, Schüsse), referieren auf die Welt. „13 Lakes“ und „10 Skies“ sind in diesem Sinne Dokumentarfilme. Weder wird, wie im Spielfilm, etwas in Szene gesetzt – außer im buchstäblichsten Sinne: durch die Kamera, die einen Ausschnitt wählt, im Raum, in der Zeit – noch sind die Bilder, die man sieht, abstrakt. Eine Böschung ist eine Böschung, der Mond ist der Mond. In einem bestimmten Sinne aber ist, anders als im gewöhnlichen Dokumentarfilm, der Gegenstand, den man sieht und wahrnimmt, nicht wirklich von Interesse. Die Seen, die Himmel sind gewöhnliche Seen und gewöhnliche Himmel. Was wir als Betrachter wahrnehmen, über kurz oder lang, und gerade dann, wenn uns die Zeit lang wird, ist vielmehr unsere Erfahrung. Als Reflexion und als Erlebnis (bis hin zum Rausch. Man kann sich, das erfährt man bei James Benning, am schieren Wahrnehmen berauschen.) Wir erleben, wie wir Zeit wahrnehmen, wir erleben, wie wir aus Wolkenschlieren am Himmel Figuren zu bilden beginnen, wir erleben, wie wir uns ganz zufällige Veränderungen in der Figuration von Licht und Schatten als „Geschichten“ zu erzählen anfangen. Natürlich sind das in einem bestimmten Sinne ganz einfache Erfahrungen, nichts Besonderes. Es sind aber auch Erfahrungen, die das Kino, wie wir es kennen, uns immer schon aufnötigt: als Gegenstand, den es hat, als Geschichte, die es uns erzählt. Indem James Benning uns den besonderen Gegenstand, die interessante Geschichte verweigert, betreibt er kinematografische Grundlagenforschung. Uns, dem Betrachter, ermöglicht er so zu erfahren, was es heißt, etwas zu erfahren. Wenn das nicht großes Kino ist. ... Link Samstag, 12. Februar 2005
Berlinale. Raymond Depardon: Profils paysans: le quotidien (F 2004)
knoerer
15:31h
Eine Frau gerät ins Bild, zufällig, weil Raymond Depardon gerade eine alte Bäuerin filmt. Sie fragt: "Werde ich gefilmt?" "Ja", sagt die alte Bäuerin. "Warum?" lautet die Gegenfrage. "Weil Sie da sind", so die schlichte Antwort. Noch sind sie da, noch geraten sie ins Bild, noch kann Depardon sie festhalten. Es sind Szenen wie diese, die das gezielte Suchen des Regisseurs kommentieren, als die Utopie des Dokumentaristen. Die Dinge filmen, wie sie sind, in dem Moment, in dem sie geschehen und vergehen. „Profils paysans: le quotidien“ ist der zweite Teil eines auf zehn Jahre angelegten Langzeitprojekts, das das bäuerliche Leben in der französischen Provinz zum Gegenstand hat, aber auch die Zeit. Es beginnt mit dem Bild eines Toten. Ein alter Mann steht in einer Tür, die Stimme des Regisseurs berichtet von seinem Tod. Der alte Mann war ein Bauer, er stand, erfahren wir, im Zentrum des ersten Teils. Eine Langzeitbeobachtung hat mit dem Tod zu rechnen. Er ist verschwunden, es gibt Bilder von seiner Beerdigung, es gibt Bilder seiner Witwe, sie ist 87 Jahre alt, auch sie wird verschwinden, nach einem Treppensturz kommt sie ins Krankenhaus, dann ins Altersheim, nüchtern berichtet es der Erzähler. Der Erzähler freilich erzählt nicht. Er notiert, er gibt sachliche, karge Informationen, nicht oft, dennoch stellt sich über diese Stimme, die nicht erzählt, sondern erläutert, ein Bezug her, zu den Menschen, die auf dieselbe Stimme des Regisseurs, der nie ins Bild kommt, reagieren. Er befragt sie. Er hat diesen Menschen von sich erzählt, mit ihnen gesprochen, das ist im Film nicht zu erfahren, aber man spürt es. Sie würden sich einem Unbekannten nicht öffnen. Und sie würden sich einem Aufdringlichen, einem Eindringling nicht öffnen. Die Kamera, die meist starr bleibt, drängt sich nicht auf, sie stellt vielmehr einfach den Raum zur Verfügung, sie bereitet ihn wie man einen Sitz, ein Bett bereitet, in dem die Gesichter, die Körper der Männer und Frauen, für die Depardon sich interessiert, ihren Platz finden. Sie öffnen sich zögerlich, sie entziehen sich auch. Über manches wollen sie nicht sprechen. Dass ihr Leben, ihr Beruf, wie sie es gelebt haben, wie sie ihn ausgeübt haben, keine Zukunft hat, das wissen sie. Sie werden darüber nicht sentimental. Es ist ein harter Job, es ist schwer, eine Frau zu finden, sagt einer, der noch jung ist. Die Jungen, die die alten Höfe kaufen, die an die Tradition anknüpfen, tun es nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit, die zur Tradition gehört. Sie kommen von anderswo, sie entscheiden sich für ein Leben, für das andere kaum mehr Verständnis haben. Raymond Depardon interessiert sich. Er sucht in der Nähe, die er zu manchen der Leute offenkundig findet, noch die Distanz, die für den Respekt unabdingbar ist. Er hat den Anstand, sich nicht in falscher Weise gemein zu machen. Er zeigt, was ist, weil es ist. Einmal geht von rechts nach links ein Mann durchs Bild, die Kamera hält das fest. Er sagt hallo, Depardon sagt hallo. Mehr nicht. Warum wird er gefilmt? Weil er da ist. „Profils paysans: le quotidien“ ist ein unspektakulärer Film und sehr viel mehr als das: ein Manifest des Unspektakulären, das alle Gier nach dem Spektakel durch seine Einfachheit beschämt. ... Link
Berlinale. André Techiné: Les temps qui changent (F 2004, Wettbewerb)
knoerer
15:05h
Von Thomas Kapielski gibt es die schöne Geschichte, wie er in einem Studentenjob einst tagelang um ein vielfaches beschleunigte Pornos auf Belichtungs- und Materialfehler hin sichtete. Am Ende des Tages wankte er aus seiner Kabine und staunte, mit welcher Langsamkeit sich die Welt um ihn herum bewegte. Ich habe soeben, scheint mir, das umgekehrte Erlebnis gehabt. Mehr als zwei Stunden lang habe ich in James Bennings „13 Lakes“ (dazu dann morgen mehr, nach „10 Skies“) starre Einstellungen von dreizehn Seen beobachtet, in denen das geringste Ereignis (ein Vogel im Vorbeiflug) innerhalb ausgedehnten Nicht-Geschehens Sensation machte. Direkt im Anschluss gab es im Berlinale-Palast André Techinés Wettbewerbsbeitrag „Les temps qui changent“, und das ist ein Film, in dem viel, sehr viel geschieht und nicht das mindeste davon rührt einen ein bisschen, interessiert einen ein bisschen, hat einem auch nur irgendwas zu sagen. Welch eine beschleunigte Welt der Nichtigkeiten. Und wissen Sie was: Es lag in Wahrheit auch nicht an James Benning. Techinés Film ist einfach belanglos, ganz und gar belanglos. Catherine Deneuve und Gérard Depardieu. Ein Mann, der seine erste Liebe nie vergisst, dreißig Jahre lang nicht, bis er auftaucht, in Tanger, wo sie jetzt lebt. Er beaufsichtigt ein riesiges Bauvorhaben, sie hat einen Job, den sie sich so nicht erträumt hat, beim französischsprachigen Radio. Sie hat einen Mann, der Arzt ist und den sie sich so auch nicht erträumt hat. Sie hat einen Sohn, der Männer liebt und mit einer Frau zusammen ist, die ständig Beruhigungsmittel schluckt. In Tanger, wo er seine Mutter nun besucht, hat er einen Geliebten, der eine Villa beaufsichtigt, die von Hunden bewacht wird. Ein Hund wird den Sohn der Geliebten ins Bein beißen und es wird nichts zu bedeuten haben. Gérard Depardieu wird von einer Erdlawine begraben werden, aber dass sich dabei etwas entscheidet, behauptet so recht nicht einmal der Film. Die Freundin des Sohnes hat eine Zwillingsschwester, die bei McDonalds arbeitet und verschleiert ist und sich nicht für Männer interessiert. Ihre Schwester will sie nicht sehen, sie hat nicht die Kraft, sagt sie. All diese Figuren und ihre Geschichten hat „Les temps qui changent“ zu bieten und er weiß nichts damit anzufangen, als sie immer wieder nur anzufangen und zu keinem interessanten Fortgang, raffinierten Variationen oder gar einem vernünftigen Ende zu bringen. Zwischendurch sitzen Flüchtlinge im Wald, zwischendurch gibt es eine kleine Verbrecherjagd in der Stadt. Wir sind in Nordafrika, Sie verstehen. Man nimmt der Figur, die Gérard Depardieu spielt, die Leidenschaft nicht ab, die dazu gehört, dreißig Jahre lang der einen Frau treu zu bleiben, die zu lieben man nicht aufhören kann. Und es ist nicht seine Schuld, es ist die Schuld eines Drehbuchs, das sich diese Geschichte selbst nicht glaubt. So bleibt Depardieu immer in der Nähe der Witzfigur, als die sich die stets ein wenig zu geistreichen Autoren einen wie ihn nur denken können, und stapft wie ein Elefant im Porzellanladen durch Nordafrika und das Leben der von ihm heimgesuchten einstigen Geliebten. Pascal Bonitzer, einer der Drehbuch-Co-Autoren, ist ein Experte für geistreiche, wenn auch etwas seichte Komödien über neurotische, Frauen verschleißende Pariser Intellektuelle. Niemand könnte ihm ferner liegen als Antoine Lavaut, die von Depardieu gespielte Figur. Die Pein, die ihn treibt, bleibt Behauptung, aufgeschminkt wie die blutige Nase, die er sich im Zusammenprall mit einer Glastür holt. Und wie es oft geht, wenn einem zur eigentlichen Geschichte nichts einfällt: Man lässt sich weitere Geschichten einfallen, zu denen einem auch nichts einfällt, aber man kriegt die Zeit herum. So kommen die übrigen Figuren ins Bild, leblos, ziellos, keiner Notwendigkeit geschuldet, es wäre genauso gut, es gäbe sie nicht, vielmehr: es wäre besser, keiner hätte sie sich je ausgedacht. Was für eine Verschwendung der Schauspielerlegenden Deneuve und Depardieu, die hier erstmals gemeinsam in einem Film auftreten. Aber immerhin hat es ja für den Wettbewerb der Berlinale gereicht, dessen Auswahlgremien unter Dieter Kosslicks Leitung auf kunstferne Schlüsselreize (Stars! Politik!) längst so zuverlässig reagieren wie der Pawlowsche Hund auf das Einschalten des Lichts. ... Link Freitag, 11. Februar 2005
Berlinale. Claire Denis: Vers Mathilde (F 2004; Forum)
knoerer
19:16h
„Vers Mathilde“, auf Mathilde zu. Claire Denis versucht sich an einem Porträt und sie wäre nicht Claire Denis, versuchte sie sich nicht zugleich an einem Essay über die Form des Porträts. Was sie zeigt, zuerst, zuallererst, sind Hände in Bewegung. Zweimal wird Mathilde Monnier, die Choreografin, an deren Porträt Denis sich versucht, betonen, wie wichtig ihr die Hände sind, in einer Bewegung, die an der Luft kratzt, Spuren zieht, die Reinheit des Raums verletzt, indem sie in ihn vorstößt. Die Kamera folgt den Händen in Bewegung, dann dem Körper in Bewegung, den Körpern der Tänzerinnen und Tänzer der Kompagnie von Mathilde Monnier in Bewegung. Wenn ein Porträt die Darstellung einer Person im festen Umriss ist, dann ist „Vers Mathilde“ kein Porträt, sondern auf dem Weg zu einem Porträt, „vers un portrait“, auf Mathilde zu. Zu sehen sind Proben, zu sehen ist bei den Proben auch der Philosoph Jean-Luc Nancy, dessen autobiografischer Essay „L`Intrus“ eine der Inspirationen für Claire Denis’ letzten Spielfilm gleichen Titels war. Wenn ein Spielfilm die Erzählung eines zusammenhängenden Plots ist, dann war „L’Intrus“ kein Spielfilm, sondern auf dem Weg zu einem Spielfilm, „vers une narration“, auf eine Geschichte zu. „Vers Mathilde“ ist ein Porträt der Choreografin Mathilde Monnier im Entstehen. Der Film gelangt nicht zum endgültigen Bild. Mathilde Monnier ist, soweit man dem Porträt, das keines ist, eine solche Zusammenfassung entnehmen kann und darf, eine Choreografin, deren dekonstruktiver Zugang zum Tanz eine andere Form des Porträts, als die des „vers“, des Prozesses, der an kein Ende gelangt, gar nicht zuließe. Es gibt keine Endgültigkeit der Darstellung, keine Kontrolle über den Körper. Der Körper führt im Tanz vor, wie er sich bewegt zwischen Kontrolle und Entzug der Kontrolle. Das Sich-Entziehen des Körpers ist im Tanztheater von Mathilde Monnier als tanzbar vorgestellt. In einer der Dialogsituationen, an der einzigen Stelle des Films, an der auch Claire Denis, die Regisseurin, kurz ins Bild kommt, sitzt Monnier verzweifelt auf dem Boden. Die Kamera filmt sie von hinten. „Es funktioniert nicht“, sagt Mathilde Monnier. „Die Tänzer finden nichts Eigenes, sie imitieren nur meine Vorgabe. Es braucht eine Lücke, einen Spalt, in dem das System bricht, in dem das Unerwartete entsteht.“ Die Choreografien, die zu sehen sind, sind Choreografien auf der Suche nach einer Form. Sie haben so die Form der Suche wie das Porträt „vers Mathilde“. Und doch, es gibt eine Annäherung, das Porträt im Entstehen gelangt zu einem Bild von Mathilde Monnier. Die Schlusssequenz beginnt als Split Screen, auf beiden Seiten der Leinwand ist die Tänzerin mit weißer Perücke zu sehen, auf den Boden, auf dem sie tanzt, wird die Tänzerin, die mit weißer Perücke tanzt, projiziert. Die Bewegungen sind fließend, es scheint ein beinahe gelöster im Körper, der hier tanzt, die Kamera fließt mit der Bewegung, die sie aufzeichnet. Claire Denis’ Meisterwerk „Beau Travail“ endet mit Denis Lavant im wilden, einsamen, zunehmend ekstatischen Tanz. Die Annäherung an Mathilde Monnier endet in diesem ruhigeren Tanz, die Bewegung des Körpers und die Bewegung der Kamera finden zur Harmonie, wenn nicht gar zu einer Art Einklang. Die Teilung der Leinwand verschwindet: Mathilde Monnier tanzt. ... Link
Berlinale. Kon Ichikawa: Yukinojos [sic] Rache (Japan 1962/3; Retrospektive)
knoerer
18:45h
Ein gelegentlicher Besuch in der Retrospektive muss sein: Zum einen alsEntschädigung für all die mediokren Filme, die man während der langen Berlinale-Tage zu sich nimmt, zum anderen auch, um den Blick auf die Leinwand wieder zu kalibrieren, der sich ans Mittelmaß zu gewöhnen droht. So ist es nicht nur ganz unwahrscheinlich, dass in irgendeinem der Säle auf der Berlinale dieses Jahres ein Film von der Klasse von Kon Ichikawas „Yukinojos Rache“ auftauchen wird. Man möchte auch glauben, dass jemand, der diesen Film gesehen hat, zu einem so lächerlichen Unsinn wie beispielsweise dem „Yukinojos Rache“ ist ein Film, der im Theater spielt und, sobald er das Theater verlässt, in einer Wirklichkeit, die zu gleichen Teilen nach den scheinbar sich ausschließenden Raumgesetzen des Theaters und des Films modelliert ist. Sogleich öffnet sich nach dem Beginn, der das Geschehen als eines auf der Bühne situiert, der Blick ins Weite. Der falsche Schnee ist echt, von einem Schnitt zum nächsten. Der Baum ist echt, die Welt ist echt. So echt die Welt des Films im Studio sein kann, wenn ein Flächenkünstler und Meister der Zweidimensionalität wie Kon Ichikawa sie in Szene setzt. Die Weite ist jedoch keine Tiefe, ein dünnes weißes Seil schwebt in der Schwärze einer atemberaubenden Kampfszene wie ein weißer Strich auf schwarzer Leinwand. Die Kamera stößt, sich oftmals mit einer der Figuren zur Seite bewegend, auf Wände, die den Blick in die Tiefe verstellen. Rasant quert der Film die Medien, denn so nah wie hier kommt das Kino der abstrakten Malerei selten, am dünnen Seil nur hängt in diesen Momenten das Bild mit der Erzählung zusammen, deren Logik es zum Schein wenigstens untersteht. Die Bühne als abgregrenzter Raum, die Weite der Leinwand als flächiger, sich aufspannender Raum und das malerische Chiaroscuro von in Bewegung gesetztem Licht- und Schattenspiel, das ist die Form dieses Films. Diese drei Darstellungs- und Bewegungsräume lässt er ineinander übergehen, setzt er zueinander in Beziehung und in sie trägt er seine Figuren ein und die Geschichten, die sie verbinden. Das Zentrum, das aber nicht alle Figuren und nicht alle Beziehungen regiert, ist die Geschichte von der Rache des Schauspielers. Drei Kaufleute haben einst in Nagasaki seine Eltern in den Tod getrieben, in Edo begegnen sie sich wieder. Er ist, als berühmter Frauendarsteller im Kabuki-Theater, der Star der Bühne und gelangt ins Haus seines Feindes, weil dessen wunderschöne, kränkliche Tochter ihn begehrt. Sie ist die Mätresse des Shoguns und verliebt hat sie sich in den Bühnendarsteller. Yukinojo aber bleibt als effeminierter Mann auch im richtigen Leben eine Kunstfigur. In Nebenhandlungen gibt es Nebenfiguren wie ein Diebespaar, das erst im Theater, dann im nie genau lokalisierbaren Draußen auf Geldbörsen aus ist. Oder einen einstigen Konkurrenten von schlechtem Charakter. Durchs Schwarz, das das Schwarz der Leinwand viel eher als das Schwarz der Nacht ist, blitzen Schwerter, auf der Tonspur flattern Gewänder. Die Kamera ist vom Imperativ des realistischen Kinos befreit, der befiehlt, Ordnung und Übersicht herzustellen immerdar. Hier kann sie sich in den Anblick eines roten Edelsteins verlieben, sich der gefilmten Wasseroberfläche überlassen, sich an die Nacht verlieren. Kon Ichikawa begreift das Kino als Komposition, als Tanz zwischen den Medien. Das Bild ist immer Kunstprodukt wie der Kabuki-Darsteller, der von der Natürlichkeit auch im richtigen Leben weit entfernt bleibt. Echt ist die Künstlichkeit, nichts anderes. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8764 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

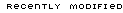
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||