
 |
... Vorige Seite
Mittwoch, 27. Oktober 2004
john peel
knoerer
12:31h
Wenn der Schock so heftig ist, dann wird mir klar, dass einer in meinen völlig unbewussten, aber selbstverständlichen Annahmen über die Zukunft noch mindestens zwanzig Jahre zu leben hatte. ... Link
Viennale-Filme VII: Abdel Kechiche: L'Esquive (F 2003)
knoerer
11:06h
Mit einer raschen Geste räumt "L'Esquive" gleich zu Beginn die Klischees beiseite, die sich mit der französischen Banlieue verbinden: Gewalt, Drogen, Banden, Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. An die Stelle dieser Klischees setzt er Marivaux. Nicht weniger also als den Dramatiker des 18. Jahrhunderts, der die scharfen sozialen Distinktionsvorschriften seiner Zeit für unbedingt komödientauglich hielt, zum Amüsement seines Publikums. Ferner kann den Jugendlichen der Vorstadt nichts liegen, sollte man meinen, als das, was die engagierte Lehrerin da angeschleppt hat und zur Aufführung bringen will. Was sich an Marivaux zeigen lässt, sagt sie, ist der Glaube an die Kraft des Sozialen, der als Lebensselbstverständlichkeiten eingeübten Gesten, Sprache, Denkungsweisen. Der Autor und Regisseur Abdel Kechiche hält das Drama, das sich rund um die Proben zu Marivaux' "Ein Spiel von Liebe und Zufall" ergibt, für unbedingt filmtauglich. Krimo, der zum Schauspiel unbegabteste Jugendliche, der sich denken lässt, verliebt sich in Lydia, die als Zofe, die sich als Herrin ausgibt, die Rolle ihres Lebens gefunden hat, im Rokokokleid, den unaufhörlich gewedelten Fächer in der Hand, der outrierte Ton der Bühnendiva sitzt ihr wie angegossen. Krimo verlässt Magali, die zu ihm passt, die ihn liebt, und übernimmt die Rolle des Harlekins, um Lydia nahe zu kommen. Die Lehrerin treibt er zur Verzweiflung, den Marivaux-Text nuschelt er in Grund und Boden. Sein Ruf ist zudem ruiniert, denn die besten Freunde pflegen eine Theaterfeindlichkeit, die der Rousseaus in nichts nachsteht. Für Männer ist das nichts, die Schauspielerin hat zudem nichts als Verführung im Sinn. Verführt jedenfalls fühlt sich Krimo, von Lydia, die mit ihm probt, mit dem Fächer wedelt, es ist im Grunde eine hoffnungslose Angelegenheit, er kommt dann endlich zur Sache, küsst sie. Sie aber, ganz die Kokette, ziert sich, bis zum Schluss, das Drama weitet sich aus auf das Umfeld der beiden. Männersachen, Frauensachen, Freunde, Freundinnen: Gender-Konflikte. Das Bühnendrama wird mit dem Lebensdrama verschränkt, auf allzu leichte Verdopplungen aber verzichtet Kechiche. Realistischerweise kontrastiert die Sprache der Jugendlichen aufs Schärfste mit der Marivaux. Der Film lässt sich aber ganz darauf ein, auf die Gesten, die Tonfälle, die Denkungsweisen. Er beobachtet, Dokumentarisches im Sinn, die Interaktionen, die Leidenschaften, Borniertheiten, minutenlangen Tiraden, Redundanzen, kommt den Jugendlichen immer wieder ganz nah mit der Handkamera, bis auf die Münder einmal, oft sind die Gesichter in Großaufnahme zu sehen. Auf jede Zurichtung ins Gefällige verzichtet er ganz, am Ende steht die Aufführung des Marivaux-Stücks, zur sentimentalen Auflösung des Liebesdramas aber kommt es nicht, die Geschichte endet im Beiläufigen. Nur einmal bricht das, was man einzig mit der Realität der Banlieue verbindet, ein, als Schock, aus dem Nichts, von außen. Eine ganz alltägliche Polizeikontrolle, eine Gewalttätigkeit, die durch nichts, was zu sehen war, gerechtfertigt ist, eine Brutalisierung des Sozialen durch den Staat, der zwanghaft Unrecht wittert. Bewundernswert die entschlossene Geste Kechiches, der hier einer anderen Realität den größtmöglichen Raum einräumt, seinen Figuren alle Zeit gibt, auch zur Redundanz, in der gerade die genaue Beschreibung des sozialen Regelwerks möglich wird. Das Theater des Marivaux fügt sich als integrierbarer Fremdkörper in diese soziale Realität - die sich dadurch als weit komplexer erweist denn vom Klischee vermutet. ... Link
Viennale-Filme VI: Benoit Jacquot: A tout de suite (F 2004)
knoerer
10:34h
"A tout de suite" ist ein Film über das Gesicht von Isild Le Besco. Isild Le Besco ist die Schauspielerin, gerade 22 Jahre alt, die als Regisseurin den wunderbaren Film "Demi Tarif" gedreht hat. Benoit Jacquot lässt die Handkamera im Schwarz-Weiß seines Historienfilms (es war der Frühling des Jahres 1975, sagt die Stimme von Isild Le Besco) in Großaufnahmen ihr Gesicht suchen, immer wieder, insistent, und umso insistenter, je mehr es sich verschließt, je weniger darin die Verzweiflung zu lesen ist, in die hinein das Leben von Lili mündet, nach dem Glück, das sie gefunden zu haben glaubte, nach dem Traum von einer Liebe, die am Flughafen von Athen endet, so beiläufig wie abrupt, ein Auto, das davonfährt, eine Geschichte, die vorüber ist. Der Rest ist Nachspiel, Verzweiflung, verzweifelte Hoffnung, leer bleibt die Leinwand, wenn sie sich fortan mit einer Großaufnahme des Gesichts von Isild Le Besco füllt. Ein Gesicht ist es, in das Lili, die Kunststudentin, sich verliebt, auf den ersten Blick. Ein junger Araber, sie zeichnet sein Gesicht, sie schläft mit ihm, er schenkt ihr ein teures Armband, er hat Geld und etwas stimmt nicht. Ein Telefonanruf, wir haben eine Bank überfallen, sagt er, der Kassierer ist tot, ich sitze fest, mit Geiseln. Er entkommt, er findet bei ihr Unterschlupf, sein Komplize, dessen Freundin, zu viert fliehen sie. Später, beim Frühstück, die eine Frau zur anderen: Du kommst auch aus dem Großbürgertum. Das ist der Grund, warum Lili, die aufs äußerste gelangweilt ist, von ihrem Leben, ihren Eltern, ihrer Familie, ihrem Studium, das Verbrechen gerade recht kommt, eine Gelegenheit zur Flucht, die sei gesucht zu haben scheint. Gerade im Bezug, der sich nahelegt, zur Nouvelle Vague, zu Godards "Außer Atem", ist "A tout de suite", als Nachspiel, als nachgeholte Geschichte eines katastrophal endenden Ausbruchsversuchs, ein finsterer Kommentar zu den 60er Jahren. In der weit reichenden Verinnerlichung seiner Motive schweigt der Film beredt zu den Hoffnungen einer Generation. Lesbar wird Jacquots Gangsterballade als Gegenstück zu Bertoluccis so sentimentalen wie nostalgischen "Träumern", dem Entwurf also einer Innerlichkeit, in dem Revolution, Liebe und Nouvelle Vague in ganz imaginärer Weise für einen Moment noch einmal zusammenfinden: eine Altmännerfantasie. Jacquots Innerlichkeit aber ist eine auf Gesichter, auf Großaufnahmen des Gesichts von Isild Le Bescos fixierte. Von Freiheit ist darin nichts zu lesen, das Glück ist von Beginn an eine Lüge. Daran ändert sich nichts dadurch, dass Lili, in Madrid, in Marokko daran glaubt. Noch in den Momenten, in denen die Fliehenden der Macht entkommen, steckt nicht das kleinste Element von Übermut, von jener jugendlichen Tollkühnheit, die die größenwahnsinnigen Gesten der Nouvelle Vague immer wieder in ihr Recht setzte. Der Terrorismus, der die eigentliche Folie dieser Geschichte ist, wird von Jacquot ins Kleinkriminelle verschoben, der Aufbruch in die zunehmend gehetzte Flucht, die Liebe in die Beinahe-Prostitution. Lesbar wird das Gesicht von Isild Le Besco, Großaufnahme für Großaufnahme, nur ex negativo, in dem, was Jacquot ausspart, vielleicht verdrängt, gerade auch, indem er der den Alltag der Zeit immer wieder in mechanischer Weise abzubilden sucht, durch den Insert von historischem Filmmaterial. Wie sich hier ein Regisseur der Post-Nouvelle-Vague den ganz hoffnungslosen Ausgang einer Rebellion erträumt, das hat etwas Unheimliches. Und ist darin sehr viel ehrlicher und treffender als Bertoluccis mit viel Rouge aufgeschminkte Revolutionsleiche. ... Link
Viennale-Filme VI: Lisandro Alonso: Los Muertos (Argentinien 2004)
knoerer
09:58h
Minutenlang durch einen Dschungel aus Grün und Licht, eine Plansequenz, die Kamera gleitet wie ein geschmeidiges Tier durchs Unterholz, das Blätterdach bleibt in der Unschärfe, verschwimmt zu einem Lichtnetz aus Weiß und Grün. Wie zufällig fällt dann der Blick, auf dem Boden, in der Schärfe, auf eine jugendliche Leiche, später eine weitere, später auf den Mörder, genauer gesagt: auf den Arm, die Hand, darin die Machete. Nach dieser Sequenz schließt sich das Lichtnetz zum undurchdringlichen Grün, das die Leinwand füllt, ein paar Sekunden. Vargas, der fast schon alte Mann, der in der Jugend seine Brüder getötet hat, wird aus dem Gefängnis entlassen. Nüchtern, kommentarlos beobachtet ihn die Kamera. Er arbeitet, er unterhält sich ein wenig mit Mitgefangenen, wird bedroht, wird frisiert, rasiert sich. Wenig, sehr wenig wird gesprochen, die Kamera hat alle Fluidität der ersten, ins Grün mündenden Einstellung verloren, überlässt sich nach dem ins Traumhafte verschwimmenden Lichtgrün des Beginns ganz dem Präsens Indikativ, bis zum Schluss, zum letzten Ende, an dem sich nichts klärt. Der Bruch ist entschieden, ja radikal. Nichts verbindet den Beginn und den Fortgang, keine Erklärung, keine narrative Brücke, dazwischen liegt nichts als das Grün des Vergessens. Keine Spekulation, kein Konjunktiv, zu sehen ist nur, was zu sehen ist. Ein Mann der frisiert wird, ein Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wird und sich aufmacht, zu einer Reise, den Fluss hinab, in den Dschungel. Der Blick der Kamera wird sich nicht mehr ins Unscharfe verlieren, aber er wird abschweifen, von Vargas, dem fast sprachlosen Protagonisten, weg, davon, nach oben, in den Himmel, der Pickup, aus dem Vargas gerade ausgestiegen ist, entfernt sich, die Kamera, verharrt auf der Ladefläche, schwenkt langsam nach oben, erst sind noch, am Straßenrand, Bäume, Zweige im Bild, dann nur noch der Himmel, die Bewegung, Natur, die nichts erklärt, deren Existenz mit der gleichen Interesselosigkeit zur Kenntnis genommen wird wie Vargas. Präsens Indikativ: Dies ist der Himmel. Das sind die Wolken. Das ist Vargas, auf dem Fluss. Die Kamera gleitet mit dem Boot, den Fluss hinab, einmal schweift sie davon, ins Braune des Wassers, verharrt hier eine Weile. Das ist das Wasser, das ist das Ufer. Und das ist Vargas, der den Bienen den Honig stiehlt. Er zündet ein Feuer an, räuchert den Stock aus, bald darauf schleckt er den Honig aus den Waben. Ein Mann, der weiß, was er tut, nach all den Jahren. Ein Schock, in der Beiläufigkeit, mit der es gefilmt wird: Vargas packt eine Ziege, die am Ufer grast, schneidet ihr mit der Machete den Hals durch, weidet sie aus, wortlos, jede Bewegung sitzt, ein Mann, der weiß, was er tut. Die Bewegung, den Fluss hinab, hat ein Ziel, Vargas sucht seine Tochter, in der Stadt hat er ihr ein Kleid gekauft. Erst gelangt er zu einer Familie, die ihn weiter weist, weiter hinein in den Dschungel, einen Flussarm hinab. Vargas trifft auf seinen Enkel, seine Enkelin, eine provisorische Behausung mit Plastikhülle. Dann stockt der Film, endet in einem Stocken, hat sich festgefressen, ohne Erklärung, ohne Ziel, in einer Einstellung, Kontrafaktur des Beginns. Vom Fluiden ins Starre, Ende einer Bewegung, einer Flussfahrt, keine Erlösung, nichts: Blick auf den Sand, zwei Spielzeugfiguren, Geräusche im Hintergrund, ein Küken, eine Wachtel laufen durchs Bild. Indikativ Präsens: Hier endet alles. Unerklärt. ... Link Dienstag, 26. Oktober 2004
Viennale-Filme IV: Arnaud Desplechin: Rois et Reine (F 2004)
knoerer
13:44h
Jump Cuts sind eine Irritationsmaßnahme, ein mutwilliger Eingriff in den normalen Lauf der Dinge, Widerstand gegen jene Form des Schnitts, die ihr Tun verbirgt und sich als Übergang vom einen Bild zum anderen so unsichtbar macht, dass man denken könnte, es gebe nichts als die Bilder und dazwischen sozusagen nur einen logischen oder grammatischen Operator, der aber Bilder zu einem Film verbindet wie, sagen wir (um aber alle einschlägigen Theorie-Diskussionen zum Thema gleich wieder links liegen zu lassen), die Regeln der Grammatik die Wörter zu einem Satz verbinden. Sichtbar werden diese Regeln nur im Verstoß und im Stolpern, und genau so ist es mit dem Jump Cut, der ein Sprachfehler, ein Stolpern des Films ist, da jedenfalls, wo er nicht experimentell ist (und Experimentalfilm heißt ja genau das bewusste Stolpern, das Suchen nach den Fehlern, die sich als das Sichtbarwerden der Geschäftsgrundlagen des Funktionierens des Normalen erweisen. Mancher Experimentalfilmer oder Theoretiker des Experimentalfilms verwechselt das Sichtbarmachen der Geschäftsgrundlagen mit der Wahrheit und ihr Unsichtbarmachen im Normalen mit der Lüge, dabei ist das Normale nur Sache der Technik und ihrer Anwendung, eine Kunst des Ausblendens der Operationsweisen, ein Verzicht auch auf Reflexion der Geschäftsgrundlagen im Dienst der Repräsentation). Das ist jetzt ein etwas langer Anlauf zu einem allerdings auch nicht kurzen (aber sehr kurzweiligen) Film, nämlich Arnaud Desplechins "Rois et Reine", Könige und Königin. In diesem Film passiert, wie man so sagt, eine ganze Menge, aber vielleicht sollte man wirklich mit dem Jump Cut beginnen. Der nämlich taucht hier auf, leise wie selten, immer wieder, kaum geschehen, schon vorbei. Eine behutsame Irritationsmaßnahme, nicht mehr als ein Blinzeln. "Rois et Reine" ist ein Film, der vor sich hinblinzelt, der einen anblinzelt, aber nicht, um einen plump ins Vertrauen zu ziehen, sondern wie Eleganz ist dabei keinesfalls mit Zurückhaltung zu verwechseln, bei aller Behutsamkeit. Der Film hat seine hysterischen Momente, denn er hat seine hysterische Hauptfigur. Ishmael (Mathieu Amalric), der von den Hunden des Finanzamts gehetzt wird und der Inbegriff einer Person ist, die ihr Leben nicht im Griff hat, wird in die Psychiatrie eingeliefert. Sein engster Kollege, seine Schwester, auch seine Eltern halten es für eine gute Idee, ihn für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen, auch weil er gelegentlich mit einem purpurnen Königsumhang auf der Straße unterwegs ist. Ishmael ruft seinen Anwalt zu Hilfe, der erst recht der Inbegriff einer Person ist, die ihr Leben nicht im Griff hat, vor allem der Drogen wegen. Der holt ihn, später, raus und hat auch schon eine Idee, wie das Schuldenproblem durch den nun erwiesenen Irrsinn Ishmaels zu tilgen ist. Ishmael wirft der Psychiaterin (Catherine Deneuve) die Ungeheuerlichkeit an den Kopf, dass Frauen leider keine Seele haben und er sucht seine Analytikerin auf, die schwarze Königin der Psychoanalyse, Madame Devereux, ihren Namen schreibt Ishmael auf einen Zettel wie ein Wort, das man nicht aussprechen darf: Und tatsächlich tut es seine zum Glück nie näher erklärte Wirkung. Was er erklärt und was er nicht erklärt, davon nämlich hat der Film so seine eigene Vorstellung, gegen keine Überraschung ist man je gefeit. Der hysterischen Hauptfigur Ishmael steht die Königin gegenüber, Nora (Emmanuelle Devos), Ishmaels Ex-Frau - nicht, dass man das sofort erfährt -, die ihren Sohn Elias über alles liebt (sagt sie), jetzt gerade ihre dritte Ehe ansteuert, in der Sex keine zentrale Rolle spielt (wird sie auf dessen Nachfrage später Ishmael erzählen) und ihren Vater verliert, den der Krebs auffrisst. Nora, der Emmanuelle Devos auf atemberaubende Weise die widersprüchlichsten Konturen gibt, ist eine Heldin, die Tod und Teufel nicht scheut und sie ist eine Teufelin, der, im dritten Teil, ihr Vater eine testamentarische Nachrede zueignet, die ihresgleichen kaum kennt - und nicht weniger überrascht als die meisten der vielen Dinge, die in diesem Film, wie man so sagt, passieren. Auf der Hand liegt, dass es um Familienclans geht, Väter, Söhne, Adoptionen, Familienbande jeder Art. Und um Personen, die nicht sind, was sie scheinen, aber auch wieder das nicht, was sie scheinen, sobald man verstanden hat, dass sie nicht sind, was sie scheinen. Die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen dem einen und dem anderen, ist nicht klarer als die zwischen Traum und Wirklichkeit und der Film wechselt zwischen beidem, souverän, behutsam, ohne alle Skrupel, mit einem Blinzeln seiner Jump Cuts. Weniger auf als unter der Hand liegen viele Anspielungen - es beginnt mit einer Lithografie, die Leda und den Schwan zeigt, und es erschöpft sich noch nicht in den vielen Gedichtzitaten und beziehungsreichen Namen, die als eine fortwährende Strömung die Geschichten und Verhältnisse, die die Figuren hier miteinander und untereinander haben, akzentuieren, konterkarieren, umspielen und unterlaufen. Nichts als Märchen seien das, die er hier erzählt, meint Desplechin bei seinem kurzen Auftritt vor dem Film, märchenhafte Geschichten von Kindern, die sich für Könige und Königin halten. Das Märchenhafte, dem freilich nichts fremd ist, der Tod nicht, die Liebe nicht und nicht der Traum, der die Wahrheit sagt, dies Märchenhafte ist vor allem die Lizenz zur Überschreitung aller Regeln, zum eleganten fortwährenden Stolpern, eine Equilibristik des sprunghaft Narrativen, die Spiele mit allem Ernst betreibt, und das Ernsthafte spielerisch. Darin liegt der fast nicht erschöpfliche Reichtum von "Rois et Reine". ... Link
Viennale-Filme III: Hou Hsiao-hsien: Café Lumière (Japan 2004)
knoerer
12:11h
Einen Ozufilm drehen, vierzig Jahre nach Ozus Tod, im Auftrag von Shochiku, Ozus Studio, als Hou Hsiao-hsien, einer der respektiertesten Autorenfilmer der Welt, ohne einen Ozufilm zu drehen, der in Wahrheit ein Houfilm wäre, oder einen Houfilm, der in Wahrheit ein Ozufilm wäre, der nur einen Knicks zu Ozu macht oder sich Ozu anverwandelt, einen Houfilm in Japan, der mit Ozu-Motiven spielt, eine Ozu-Geschichte, die als Houfilm erzählt ist, aber als Ozufilm kadriert, mit einem Ozuvater, halb verstummt, einer Ozutochter ganz von heute, also von diesem verstummten Vater kaum mehr beeinflussbar, wie soll das denn glücken. Es glückt nicht recht, leider. Natürlich ist "Café Lumière" ein Film, den man gerne sieht, in dessen langen, ruhigen, dem Leben als Film eine Form, aber keine strenge, keine scharfe Form gebenden Einstellungen man sich wohl, wenn nicht aufgehoben fühlen kann. Aber dem Houfilm, den das ausmacht, die Stille, die Form, das Zusehen beim Sich-Ereignen, dem kommt hier der Ozufilm dann doch in die Quere. Anders gesagt: Er zieht sich da einen Mantel an, der ein Ozu-Mantel ist und für Hou zu eng ist (während er natürlich dem Ozufilm sitzt wie angegossen und weder gegen Hou noch gegen Ozu ist damit etwas gesagt). Wenn es in "Café Lumière" den Betrachter manchmal kneift, dann hat das mit dem Ozu-Mantel zu tun, in den sich der Houfilm nicht fügen will, oder mit den Ozu-Erwartungen, die Hou schürt, ohne sie erfüllen zu wollen oder zu können. Ozu ist ein Melancholiker und ein Humorist, wenngleich er zu den verblüffendsten Sublimierungen und Subtilisierungen und Verdünnungen dieser Neigungen fähig ist - so dass man meinen könnte, er sei ein Beobachter und Meister des Nebenbei, wie Hou es ist. Das aber täuscht und in "Café Lumière" ist zu sehen, dass zwischen beiden doch ein Abgrund klafft und sie sich nur von Gipfel zu Gipfel nahe scheinen. Das erste Bild: ein Bahndamm, eine Bahn. Kein Ozufilm ohne Bahn und sei es als Rattern im Hintergrund. Hier ist die Bahn ein Zitat, das Hou zur running hommage erweitert, indem er eine Figur einführt, die es sich zum Hobby gemacht hat, Bahngeräusche aufzunehmen, eine Figur, die vor allem dieser Idee geschuldet scheint, die haben zu sollen Hou aus Hommagegründen glaubt. Die nächste Einstellung: eine junge Frau (die Tochter des Ozuvaters, wie sich später zeigt) in einem ozuartig gestaffelten Bild, Seitenbegrenzungen begrenzen als gestufter Rahmen das Bild von innen wie bei Ozu. Die Kamera sitzt recht tief, wie für den Ozu-Spätstil typisch. Die Tochter hängt Wäsche auf, die dann im Wind hängen wie in einem Ozufilm. Ein unglücklicher Beginn, denn man fühlt sich geradezu aufgefordert, weiter nach Ozu-Zeichen und -Zitaten zu suchen. Der Film startet sozusagen auf dem falschen Fuß und man kommt nicht mehr recht raus aus dem Gefühl, in einem doppelt falschen Film zu sitzen, einem Ozufilm, der ein Houfilm ist und einem Houfilm, der ein Ozufilm ist. Hou erfindet als Plotknoten eine kleine Allegorie seiner Unternehmung: Seine Heldin ist schwanger von einem Taiwanesen, den sie nicht heiraten will, wogegen der Vater etwas hat, aber schweigend, insistent schweigend, und dann auch einmal Sake trinkend aus der Flasche, die die Tochter von der Nachbarin hat wie in einer Szene von Hous "Tokio Story", wenngleich da gerade nur die Mutter bei der Tochter zu Besuch ist. Ausagiert aber - wie es ganz unweigerlich bei Ozu der Fall wäre - wird der Konflikt im Grunde nicht, Hou folgt seiner Heldin durch Tokio, Bahn fahrend, beobachtend, einem Komponisten nachforschend, der auch Fotograf war, einmal hört sie mit dem Buchhändler Musik des Komponisten, dem Buchhändler, der daneben eben auch noch die ins obsessiv Bahnverrückte übersteigerte Ozu-Hommage ist. Diese Szene ist sehr schön, das Understatement, mit dem die beiden einander näher kommen. Ihr und ihm durch Tokio zu folgen, gehend, dem Komponisten nachforschend, Bahn fahrend, all das ist schön, man kann sich in Hous langen, ruhigen nebenbei beobachtenden Einstellungen aufgehoben fühlen. Aber ohne Ozu, muss man leider sagen, wäre es noch schöner, weil Interferenzen in Form von Anspielungen, Hommagen, Story- und Kadrierungszitaten dem Houfilm fremd bleiben und äußerlich und was man lernen kann, ist eben vor allem, dass der Ozufilm dem Houfilm weniger nahe ist, als man zunächst denken könnte. ... Link Montag, 25. Oktober 2004
Viennale-Filme II: Arnaud des Pallières "Adieu" (F 2004)
knoerer
10:06h
Zehn Monate hat Arnaud des Pallières am Schnitt von "Adieu" gearbeitet, Bild und Ton gleichzeitig, das eine und das andere von einander nicht trennbar; hat er nicht am Bild gearbeitet, nicht am Ton, sondern am Bildton. Einzig von diesem Faktum her ist sein Film zu denken. Schon der Beginn, der die Choreografie einer Automontage entwirft, ohne das, was man Originalton nennt, also den Ton, den der Tonmann da (sucht und) findet, wo der Kameramann die Bilder (sucht und) findet, also in der vom Regisseur inszenierten Wirklichkeit. Diese Choreografie ist zunächst auf Einzelteile fixiert, schneidet sie als Montage von fließenden Cuts aneinander, bis ein Auto entstanden ist, durch keiner Hände Arbeit (der Cutter macht seiner Hände Arbeit unsichtbar wie die Bilder die Hände der Arbeiter unsichtbar macht), Maschinen, die eine Maschine zusammenbauen, Schnitt für Schnitt. Dazwischen gestückelt der Vorspann, der Namen nennt, Michael Lonsdale, den Namen, der ein Versprechen aus Kinogeschichte ist, ein Schauspieler, der nur wenige Auftritte haben wird, in diesem Film, seinen ersten sitzend, nur von hinten zu sehen, massig, er wird angekleidet. Am Ende wird er, die Figur, der Vater, der nie spricht, der massige Körper, der sich zurückzieht aus der Welt, beim Sterben zu sehen sein, die Kamera fährt von links nach rechts, unterbrochen durch eine massive Unschärfe im Vordergrund, eine Stimme spricht, wessen Stimme es ist, ist nicht ganz klar, wohl die Stimme eines Toten und der Vater, gespielt von Michael Lonsdale, stirbt, erlischt: Adieu. Der Vorhang, rot, durchsichtig, ein Bett dahinter, eine Stimme spricht, sie adressiert eine Frau, meine Prinzessin. An einem Fenster ein Mann, der schreibt. Zu hören ist seine Stimme, er blickt über die Stadt, es ist eine Stadt in Algerien, die Kamera schwenkt von seinem Gesicht hinaus in die Unschärfe, die scharf wird, Minarette, die Häuser, der Himmel. Die Stadt, die der Mann verlassen wird. Er wird fliehen, nach Frankreich, er erzählt, mit der Stimme, die eine Frau adressiert, meine Prinzessin, die biblische Geschichte von Jonas, den Gott als Boten nach Niniveh schickte, als letzte Chance vor der Zerstörung. Jonas aber floh, auf, davon, auf dem Schiff, davon erzählt die Stimme des Mannes. Wäre "Adieu" ein Film mit einem Plot, einer Geschichte, die man erzählen kann, wäre dies der eine Strang. Der Mann, der flieht, nach Frankreich. Man kann das aber nur so zusammenfassen, wenn einem Hören und Sehen längst vergangen ist. Die Musik, die in fast jedes Bild eingelassen ist, ist mehr als Tonspur. Mit dem gleichen Recht wäre von einer Bildspur zu sprechen, die in die Musik eingelassen ist. Das eine verhält sich zum anderen nicht kommentierend, nicht illustrierend, nicht untermalend. Die Bilder werden andere unter der meist ins Sakrale gehenden Musik, die Musik wird eine andere unter den zögerlich ins Narrative sich fügenden Bildern. Ein Vater, seine Söhne, im Fernseher ein Kinderchor. Der weiße LKW, im Vorspann unter Schnitten montiert, auf der Straße, ohne Originalton, dahingleitend, schwebend, über Musik, Musik in Bewegung. Am Ende wird er, ohne dass das nahtlos, illustrierend ineinander aufginge, der Wal sein, in den Jonas gerät, von Gott verlassen, weil er vor Gott geflohen ist, ein allegorischer LKW, aber die Allegorie bewahrt sich den Spielraum, der nicht zwischen Bild und Ton liegt, sondern im Ineinander, das alle semiotischen Eindeutigkeiten auf Abstand hält. Zur Musik das Gesicht eines Mannes unter Wasser, der vom Besuch bei der Nachbarin erzählt, der er Melonen bringt, die er beim Sex stört. Er ist einer der Söhne des Vaters, der am Ende stirbt, der Bruder des jungen Mannes, der ums Leben gekommen ist. "Adieu", Abschiede über Abschiede. Der Priester, der nicht mehr an Gott glaubt, man sieht und hört ihn seine Predigt proben, man sieht ihn Gottesbeweise vortragen, einen nach dem anderen, bis er nicht mehr weiter weiß, nach Aspirin verlangt. Die heftigste Erschütterung, eine Erschütterung wie in den Filmen von Philippe Grandrieux, ein Bildbeben während des Abschiedsgottesdienstes: Ein Zittern, eine Überblendung, der Schrecken des Tons darin, zu sehen ist ein Kreuz, der Himmel, die Kirche. Die Bilder zeigen nichts, das irgend jemand sieht. Sie zeigen nichts Wirkliches, sie zielen auf die Erschütterung, die sie sind, als Verrückung von Bildton, Tonbild ins auf die Gegenwart einer Wirklichkeit nicht mehr Hinrechenbare. Vor der Größe solcher Anschprüche ans Kino, das macht die Größe des Films aus, schreckt Arnaud des Pallières nie zurück. Man wird die Ästhetik, zu der sich seine Bild-Ton-Allegorien zusammenschließen, als eine Ästhetik des Sakralen bezeichnen können, sakral noch in der Gottverlassenheit der Welt, die darin entworfen wird. "Adieu" ist ein Film, der mit aller Entschlossenheit das Kino verrückt, an einen Ort, den es noch nicht gab. Er denkt die Welt anders als sie bisher gedacht worden ist, er erschließt dem Zeit- und Bewegungsbild einen neuen Raum. Mit aller Peinlichkeit und allem Pathos, die in dieser Hybris liegen. ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8764 Days
last updated: 26.06.12, 16:35 furl
zukunft homebase
film
auch dabei fotoserien cinema vollständig gelesene blogs
new filmkritik
aus und vorbei
darragh o'donoghue
 Youre not logged in ... Login

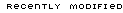
nasal Ein Leserbrief in der
morgigen FAZ: Zum Artikel "Hans Imhoff - Meister über die...
by knoerer (17.02.09, 19:11)
live forever The loving God
who lavished such gifts on this faithful artist now takes...
by knoerer (05.02.09, 07:39)
gottesprogramm "und der Zauber seiner
eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit...
by knoerer (28.01.09, 11:57)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||